
Wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie nie eine Autorin geworden. Sie hatte doch nur Briefe mit ihrem Ehemann gewechselt! Man war frischverheiratet, der junge Arzt war von Halle nach Hamburg umgesiedelt, wo er eine vielversprechende Praxis eröffnet hatte; und bald würde sie, Johanne Charlotte, ihm dorthin nachfolgen. Und um die Trennung zu überbrücken, wechselte man eben Briefe. Es waren jedoch keine gewöhnlichen Liebesbriefe, oh nein; und eine andere, schwächere Frau als Johanne hätte sie wahrscheinlich eher als das Gegenteil eines Liebesbriefs bezeichnet. Denn Johann August schickte seiner Herzallerliebsten Johanne viele engbeschriebene Seiten mit – einer selbst gefertigten Übersetzung einer neuen philosophischen Schrift aus dem Lateinischen. Es handelte sich dabei um Alexander Baumgartens Metaphysica; einem Grundwerk der sich seit einiger Zeit in Halle, der gemeinsamen Heimat von Johanne und Johann, formierenden neuen deutschen Schul- und Systemphilosophie, die die berühmte „mathematische Methode“ jetzt auch in Deutschland zur allerneuesten akademischen Mode gemacht hatte und deren Haupt- und Grundlagenwissenschaft natürlich die Metaphysik war: also diejenige Wissenschaft, die im Regal bei Aristoteles nach der Physik kam (eine Anekdote, die so hübsch ist, dass man sie immer wieder erzählen kann). Denn natürlich war Baumgartens akademische Grundlagenschrift in der akademischen lingua franca verfasst, lateinisch also – schließlich war sie für Gelehrte bestimmt, nicht aber für bildungshungrige Frauenzimmer, die von ihrem Ehemann ein wenig Philosophie-Nachhilfe bekamen.

Und so bekam Johanne zur Vermählung sozusagen, wahrscheinlich die erste Übersetzung der Metaphysica ins Deutsche überhaupt. Und sie schlug sie ihrem fernen Ehemann nicht in absentio um die mit philosophischer Röte angehauchten Medizinerohren, sondern sie – verschlang sie, versuchte sie zu verstehen, fragte zurück, suchte nach Beispielen, fand sie in der Literatur; ja, kommentierte und kritisierte Baumgarten sogar gelegentlich. Unerhört. Sie, das Frauenzimmer, kaum 34 Jahre alt! Aufgewachsen nicht nur ohne Lateinunterricht, sondern wahrscheinlich ohne formale Bildung überhaupt! Woher wir das alles wissen? Nun, die ehelichen Briefe sind nicht überliefert; überliefert ist aber Johanne Charlotte Unzers Grundriss einer Weltweisheit für das Frauenzimmer, veröffentlicht 1751, beinahe die erste Schrift ihrer Art und sozusagen das gereinigte Protokoll des Briefverkehrs. Wie konnte das passieren? Wie wurde Johanne Charlotte Unzer eine Weltweise?

Geboren wurde Johanne 1727 in Halle, zu dieser Zeit eine berühmte Universitätsstadt ebenso wie eine Hochburg der protestantischen Reformbewegung des Pietismus, berüchtigt für ihre Sittenstrenge und ihre Kunstfeindlichkeit; soeben begann sich aber auch eine neue Dichtung dort zu etablieren, sie nannte sich „Anakreontik“, und sie pries skandalöserweise den sinnlichen Lebensgenuss! Dieser sehr besondere, reichlich widersprüchlich, aber auf jeden Fall anregende Hallensische genius loci hat einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Johanne zur Weltweisen wurde. Denn in die Wiege gelegt wurde es ihr nicht direkt; wenn es danach gegangen wäre, hätte sie eher eine berühmte Musikerin werden müssen. Ihr Vater galt in seiner Kindheit als musikalisches Wunderkind, erhielt später Unterricht von Johann Sebastian Bach und hatte in Halle eine angesehene Stellung als Musikdirektor und Organist inne. Von Johannes musikalischen Fähigkeiten ist jedoch niemals die Rede. Immerhin spielte die Musik trotzdem eine Rolle; denn ihr späterer Ehemann, der junge Johann August Unzer mit den philosophischen Briefen, war einer der vielen Musikschüler des Vaters. Dazu kam eine weitere, etwas entlegenere familiäre Prägung: Der Bruder ihrer Mutter nämlich (von der Mutter wissen wir, wie meist im 18. Jahrhundert, rein gar nichts), Johann Gottlob Krüger hieß er, hatte sich ebenfalls gerade als Mediziner und als Philosoph einen Namen in Halle gemacht. Krüger schrieb auch gern, viel und zudem unterhaltsam; zu seinem weit gestreuten Oeuvre gehören Texte wie die Gedanken über den Tee und den Kaffee, ein Versuch der Experimental-Seelenlehre oder Träume. Und Krüger wurde zum zweiten Mentor Johannes, neben dem Ehemann. Er nahm sie nach dem Tod des Vaters unter seine Fittiche und beflügelte ihren Bildungshunger noch erheblich: Denn er war es, der sie zur Veröffentlichung des Ehebriefwechsels unter dem Titel eines Grundriss einer Weltweisheit mehr oder weniger – zwang.

Dazu musste jedoch noch ein dritter Mentor kommen, um die spezifisch Hallensische Mischung, in der Johanne Charlotte Unzer zur Weltweisen – und zur Dichterin, wie wir jetzt ergänzen müssen, einer anakreontischen noch dazu! – gemacht wurde, zu vervollkommnen. Er hieß Georg Friedrich Meier, war nur geringfügig älter als seine Co-Mentoren Unzer und Krüger und ausnahmsweise nicht Mediziner, sondern wirklich und hauptberuflich Philosoph. Er vertrat dabei jedoch eine durchaus lebensfreundliche, wie man damals zu sagen begann: populäre Form der Philosophie. Zwar blieb er inhaltlich streng in den Spuren der großen Hallensischen Schulphilosophen Wolff und Baumgarten, legte jedoch Wert darauf, dass die Philosophie für alle zugänglich sein sollte, nützlich obendrein und überhaupt ein Grundpfeiler des bürgerlichen wie religiösen Lebens: Ein wahrer „Weltweiser“ war eben jemand – der weise war für die Welt, nicht für die Schule, die Akademie, den engen Kreis der Gelehrsamkeit. Ein solcher Weltweiser jedoch musste auch zur Welt sprechen können – also: zumindest zu ihrem gebildeten, zunehmend bürgerlich geprägten Teil –, und nicht nur zu den Kollegen. Und damit die Welt ihn verstand, ja, mehr noch, damit sie ihm gern zuhörte und seine Weisheitslehren auch beherzigte, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, dafür musste er – weltlich sprechen. Also: nicht lateinisch, deutsch. Kein Fachvokabular, sondern wohldefinierte Alltagssprache. Beispiele und Erfahrungen statt strenger Sätze, gern auch aus der Literatur. Vor allem aber: schön! Und schön, das heißt für Meier: anschaulich und lebendig, gern auch witzig. Witz, das war damals noch nicht das etwas heruntergekommene Stiefkind des Humors, sondern ein wichtiges geistiges Vermögen, es bedeutete: Jemand konnte gut Ähnlichkeiten entdecken in Dingen, die äußerlich unähnlich sind. Verborgene Verbindungen, Zusammenhänge, die die Philosophie vielleicht noch gar nicht gefunden hatte. Schleichwege der Vernunft. Deshalb schrieb Meier eines Tages, neben seinen vielen fachphilosophischen Texten, die Gedanken über Scherze: eine kleine Populärphilosophie des mäßigen, heiteren, gesitteten, geselligen Scherzens und seiner segensreichen Wirkungen. Und gescherzt wurde, so konnte man vernehmen, auch bei ihm zu Hause gern. In seinem geselligen Kreis verkehrten die jungen Dichter wie die jungen Ärzte, aber natürlich auch die jungen Damen, ziemlich sicher also auch: die junge Johanne Charlotte; und sie wurde eines seiner besten Schülerinnen. Im Scherzen nämlich, aber auch in der Weltweisheit. Denn hatte Meier nicht selbst geschrieben, in einer seiner moralischen Wochenschriften: „Ich wünsche daher, dass jemand eine Logik und Metaphysik fürs Frauenzimmer schreiben würde. Man müsste alles weglassen, was für Erzphilosophen gehört, und man müsste das übrige auf eine ästhetische Art vortragen; so würde man auch eine Logik und Metaphysik für Kavaliere bekommen“?
Drei Mentoren also, ein Dreiergestirn umtanzt die junge Johanne Charlotte Unzer und verlockt sie: zur Philosophie, zur Dichtung, zum Scherzen. Vergessen ist der alte Pietismus, die neuen Dichter haben einen neuen Propheten entdeckt: Anakreon heißt er, ein alter griechischer Dichter, der längst vergessen wäre, hätte er nicht die unsterbliche Formel von „Wein, Weib und Gesang“ geprägt und in unzähligen Liedern variiert. Anakreon war der Dichter der Lebensfreude, des geselligen Scherzens ganz in Meiers Sinn, und genau das, was man brauchte, um den Pietismus endgültig zu vergraulen. Auf einmal erscheinen allenthalben „Scherzgedichte“ in der Tradition Anakreons; vom Frühling ist von ihnen unausweichlich die Rede, von den Freuden der Jugend und des Rebensaftes, von der Liebe sowieso und, befremdlicherweise, häufig von Schäfern (sie sind aber nur ein Vorwand; schon bei Anakreon ging es nicht wirklich um Schäfer, einen mühsamen und schmutzigen Beruf, sondern um eine idealisierte Lebensform). Natürlich wirkt das heute alles ein wenig bemüht und ziemlich altbacken. Gleichwohl kann man, ein wenig Witz vorausgesetzt, eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen „Wein, Weib und Gesang“ und „sex and drugs and rock’n roll“ feststellen: Die Freuden des Menschen sind sparsam gesät, schon immer und immer noch; und Wasser, Askese und Prosa sind einfach keine attraktiven Gegenstände der Dichtung, noch nie und immer noch. Nein, wenn man die Freuden des Lebensgenusses besingen will, kommt mehr oder minder immer das Gleiche heraus. Es kommt aber zum Glück auch gar nicht darauf an. Denn was zählt, ist der Geist, ist die Stimmung, ist der Ton – heute weiß die Neurobiologie, dass Lachen fröhlich macht, es ist gar nicht umgekehrt oder zumindest nicht einsinnig kausal; nein, wenn man lange genug so tut als ob, wird man plötzlich fröhlich! Man muss den Wein dazu noch nicht einmal trinken (der Punkt wird aber bei den Drogen meist nicht gemacht). Man bekommt auch keine Kinder von einer erdichteten Schäferliebe (und Zeiten nach der Erfindung der Geburtenkontrolle sollten sich das in vollem Ernst klarmachen: Ungezügelte Sexualität war vor der Pille kein erstrebenswertes Freiheitsrecht, und schon gar nicht für die Frauen). Ach, es ist so schwer heiter zu sein, und doch so notwendig! Können da ein paar Scherzgedichte mehr schaden, auch wenn sie unoriginell sind, Standardware, immer die gleichen Reime, immer die gleichen Scherze? Können nicht auch Frauen mit – scherzen, sie dürfen ja auch mittrinken (Weingenuss war sehr viel verbreiteter im 18. Jahrhundert als heute, ganz einfach deshalb, weil der Wassergenuss die ungleich höheren Gesundheitsrisiken hatte)?

Johanne also beginnt zu schreiben, inspiriert vom dreifachen Hallenser Geist des Scherzes, der Metaphysik und der Populärphilosophie, vielleicht auch ein wenig vom mäßigen Weingenuss. Im Jahr ihrer Verehelichung, 1751, kommen ihre zwei Erstlingswerke auf den Markt, und schon die Parallelität verweist auf – Ähnlichkeiten, aber vielleicht ja auch Unterschiede (dafür ist, im Gegensatz, nein: in Ergänzung zum Witz, der Scharfsinn verantwortlich). Das eine ist der Versuch in Scherzgedichten, eine – weibliche? – anakreontische Scherzdichtung; das andere ist der Grundriss einer Weltweisheit für das Frauenzimmer, eine – weibliche? – philosophische Grundlagenschrift. Der Grundriss ist schwerer Stoff: Er enthält die philosophische Logik samt Metaphysik, dazu eine Seelenlehre und eine Naturlehre, ganze neunhundert Seiten. Sie sind die Essenz des Ehebriefwechsels, ans Licht gezerrt von Onkel Krüger, dem stolzen Mentor, der das Werk mit einer Vorrede einleitet und reichlich mit Kommentaren versieht. Er hatte auch angeordnet, dass es eben in dieser Form erscheinen sollte, also die vollständige Logik und Metaphysik enthalten musste, die Johanne ganz sicherlich gekürzt hätte, wenn sie denn wirklich nur und ganz allein für Frauenzimmer als Frauenzimmer hätte schreiben dürfen. Immerhin hat es sie es aber durchgesetzt, dass die Seelenlehre, der ungleich interessantere Teil, am längsten wird. „Mein eigen“, so erläutert Johanne in der späteren Vorrede zur zweiten Auflage, „ist nichts als die Einkleidung des Vortrags und die Wahl von einigen Exempeln und Verzierungen: Ich glaube gewiss, dass eine Philosophie für das Frauenzimmer weit anders gerichtet sein müßte“. Natürlich ist ihr später diese Unoriginalität immer wieder zum Vorwurf gemacht, von gelehrten Männern natürlich: kein eigener Gedanke, ausgeprägte Frauenzimmerlichkeit, Patzer in der Logik, was hat man ihr nicht alles vorgeworfen! Dabei wollte sie noch nicht einmal eine Autorin sein. Sie wollte nur ein wenig Philosophie verstehen. Und sie hatte Meier geglaubt, dass eine Philosophie für Frauenzimmer – und für Kavaliere – eben eine andere sein müsste. Also hat sie daran gearbeitet, ihre Weltweisheit – wenn sie den Inhalt schon nicht ändern durfte – schön, angenehm, lebendig darzustellen. Sie anders „einzukleiden“, eine typische Frauenzimmermetapher, ist man geneigt zu sagen; ach, und wenn schon, könnte man mit ein wenig geschlechtlicher Souveränität antworten: Ist es denn besser, auf Einkleidung zu verzichten? Wollen wir denn alles immer nackt sehen? Gibt es nicht gute Gründe für – geschmackvolle Kleider, gut geschnitten, dem Anlass angepasst, schön für das Auge und angenehm zu tragen? Lasst die männliche Philosophie halt nackt, wenn ihr meint, das muss sein; aber erlaubt der weiblichen Kleider. Sie verhüllen oft weniger, als dass sie etwas zeigen (Charakter, zum Beispiel).
Und so kleidet Johanne ihre Weltweisheit munter ein, wo sich eine Lücke findet zwischen all dem Definieren von Grundsätzen und Begriffen und dem Herleiten von Schlüssen. Sie sucht ein interessantes Beispiel für eine Lehre, sie findet es in ihren Lieblingsautoren, sie flicht es ein, mit Geschmack und Gefühl für Proportionen. Sie kommentiert, mal vorsichtig, mal aber auch bissig, die neueste philosophische Mode, die „Demonstriersucht“ und ihre seltsamen Begleiterscheinungen. Sie kann auch einen Schluss am Schopf fassen und ihn dazu verwenden, völligen Unsinn logisch korrekt herzuleiten (das ist das Wesen von Syllogismen, ihre Schlussätze sind immer nur so gut wie ihre Vordersätze). Sie wendet sich immer wieder explizit an ihre Leserinnen (offenbar geht sie davon aus, dass sich ein männlicher Leser nicht in den Text verirrt, und auch darin wird sie Recht behalten haben), bittet um ihr Verständnis, um Geduld, wirbt aber auch für die Mühen des Begriffs und der Philosophie. Denken lernen, das ist ihr Tenor, schadet gar nie; es schult die Aufmerksamkeit, die man euch doch so gern abspricht, wenn man euch zu verspielten, des Denkens von Natur nicht fähigen Puppen erklärt. Aber nur mit Konzentration, Übung, Arbeit bringt man es zu etwas, sei es im Leben oder im Denken! Beobachtet, so predigt sie immer wieder, beobachtet alles, in jeder Situation, setzt euch möglichst vielen Erfahrungen aus, ich weiß, ich weiß, sie wollen euch davor schützen, die Männer, aber versucht es trotzdem: Je mehr man erfährt, je mehr man beobachtet und anschließend darüber reflektiert, desto mehr – kann man eigene Ideen haben. Denn das ist es, so fährt Johanne ziemlich mutig und kernaufklärerisch fort, worauf es ankommt: eigene Ideen haben! Nicht das nachbeten, was andere gesagt haben, vermeintlich Klügere, Gebildetere. Seht nur, all diese hochgebildeten Männer, diese düsteren Metaphysiker, was haben sie nicht alles für Sätze aufgestellt, über die menschliche Seele zum Beispiel, ist sie nun eine „Monade“, wie der philosophische Halbgott Leibniz behauptet, oder nicht? Teilbar oder unteilbar? Materiell oder Geistig? Und wo wohnt sie eigentlich? Und dann sagt sie: Vergesst es einfach. All das kann man nämlich gar nicht wissen (sie begründet das religiös, man könnte es aber auch einfach nur skeptisch begründen). Man kann nur Meinungen darüber haben. Und wisst ihr, was Meinungen sind? Auffassungen über Dinge, die man nicht wissen kann. Und dann streiten sie sich, die Philosophen, die düsteren Metaphysiker und Schulfüchse, ohne Ende, ohne Sinn und Zweck, und vor allem: ohne jegliches Ergebnis. Ach, vergesst es doch! Und dann erzählt sie eine Geschichte über eine Seele, die verzweifelt ihre Wohnung sucht, sie ist ziemlich lustig. Oder sie erfindet eine künstliche Debatte darüber, dass auch die Pflanzen eine Seele haben kann. Ja, genau, kann man alles syllogistisch aufs schönste beweisen, man muss nur möglichst verkehrte Vordersätze aufstellen, dann wird der logisch korrekte Schluss schon auf seinen drei Beinen dorthin hinken, wo man ihn haben möchte.
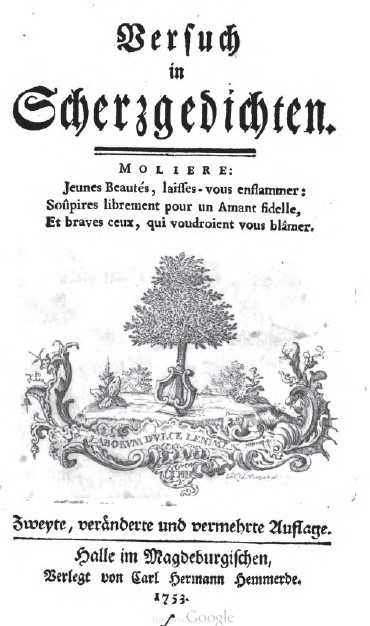
Die im gleichen Jahr erscheinenden Scherzgedichte sind die scherzhafte Rückseite der düsteren Weltweisheit; man braucht nicht viel Witz, um das zu sehen. Nicht zu wenige tändeln einfach nur anakreontisch daher, aber das tun diejenigen der Männer auch. Die wirklich originellen aber führen absurde Beweise in Versform vor; sie lehren, wie man die düsteren Gelehrten küsst anstelle ihnen zu viel zuzuhören, die Weisheit ist ihnen eine heitere, beschwingte Angelegenheit und Demonstrieren auch nicht schwerer als Quadrille tanzen. Und wenn die Dichterin schließlich in einem Gedicht an den gelehrten Onkel Krüger verkündet, was auf ihrem Grabstein stehen sollte – nämlich: „Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein!“, genau siebenmal, aber eigentlich genau so oft, wie es auf den Grabstein passt – dann ist das schon höhere Frechheit jenseits des anakreontischen Motivgeplänkels.

Die Scherzgedichte sind unbeschwerte Jugendwerke; wenige Jahre später schlägt das Leben zu. Johanne war, 1751 noch, nach Altona zu ihrem Ehemann gezogen, also gab es keine philosophischen Briefe mehr. Sie hatte dort einen geselligen anakreontischen Kreis gegründet, nach dem Meier‘schen Vorbild in Halle, man hatte hübsche Schäferspiele gespielt und sogar eine Zeitschrift veröffentlicht. Ihre Scherzgedichte sind so erfolgreich, dass bald eine zweite Auflage erfolgt. Onkel Krüger hatte ihr außerdem, das schmückt die Autorin enorm, eine Dichterkrönung an der Universität Helmstedt verschafft, deren Rektor er inzwischen war – beinahe die einzige Möglichkeit im 18.Jahrhundert, als Frau an einen Doktortitel zu gelangen, wenn auch einen mehr ehren- als ernsthaften. Und wahrscheinlich war das eheliche Glück vollkommen, als Johanne Zwillinge bekam. Doch aller ärztlichen Künste zum Trotz sterben beide Kinder im Säuglingsalter; danach ist auch Johanne selbst lange Jahre kränklich. 1754 hatte sie immerhin noch einmal einen neuen Gedichtband veröffentlicht, den Versuch in sittlichen und zärtlichen Gedichten. In ihm hatte sie nicht nur einen höheren poetischen, sondern auch einen höheren ethischen Anspruch an sich selbst erhoben: „Sittliche Gedichte“ sind keine unverbindlichen Scherze mehr; sie haben einen ernsten Gegenstand, beinahe: den ernstesten überhaupt, und sie verlangen strengere Formen. Johanne sagt in der Vorrede mit der ihr eigenen Redlichkeit: Es könne durchaus sein, dass sie dem Anspruch, den diese „wichtigen Unternehmungen“ an die Autorin stellen würden, nicht gewachsen sei. Das ist ganz normal, ein Bescheidenheitstopos, wie er sich in den meisten Vorreden der Zeit findet. Ungewöhnlich ist aber die Fortsetzung des Gedankens bei Johanne: „Ich wollte aber doch Versuche nicht unterdrücken, woraus man sehen kann, dass ich sie zu besitzen wünsche“. Es kommt nicht auf das Ergebnis an, sondern auf den ernsthaften Wunsch und das Bemühen. Das kann man dilettantisch schelten; man kann aber auch erwägen, dass gerade aus unvollkommenen, aber persönlich empfundenen Texten, Gedanken, Ideen oft mehr zu lernen ist als aus blankpolierten Meisterstücken der Unverbindlichkeit.
Zu finden ist in dem Band beispielsweise, neben einem wahrhaft rührenden Gedicht über den Tod ihrer Kinder, ein umfängliches Gedicht mit dem Titel Gedanken über die Verwesung. Die Autorin blickt dem Tod ins Auge (sie hat dem Tod ins Auge geblickt, im Leben); und sie beschreibt, was sie sieht: nämlich Moder. Verfall. Blasse Gesichter, erkaltete Glieder; blaue Lippen, ekelhaft verblichenes Wangenrot; steife, im Todeskampf verkrampfte Hände; der „Sitz der Lust“, die schöne Brust, eingefallen; Leichengeruch, Würmer, und am Ende: nichts als Staub. Gemeinglich gilt Charles Baudelaires Gedicht La charogne (Das Aas) als erstes Gedicht auf die Verwesung. Die Literaturgeschichte muss korrigiert werden: Johanne Charlotte Unzer hat gut hundert Jahre vorher ein Gedicht über die Verwesung geschrieben. Sie ist die Gattin eines inzwischen berühmten und erfolgreichen, immer noch an der Philosophie laborierenden Arztes; und sie hat den Tod gesehen. Für die Sorte Philosophen hingegen, die den Leib verachten, hat sie nur Spott – und außerdem eine ordentliche Portion Lebensweisheit: Denn möglich, denkbar und damit wirklich sei durchaus, dass, wenn es wirklich soweit sei und der Leib sich verabschiedet – „dann der wohlgezähmte Wille / Nicht so viel Lust nach jener neuen Hülle“ fühle (Schopenhauer wird es hundert Jahre später nicht viel anders sagen; den Willen kann man nicht zähmen), denn: „Im Tod erwacht manch nie gefühlter Trieb, / der lebenslang in tiefem Schlummer blieb!“ Das einzig angemessene Verhältnis jedoch der Philosophen wie des Menschen zu seinem Körper sei ein ganz anderes – und um dieser Zeilen allein willen ist Johanne Unzer eine echte Philosophin und eine echte Dichterin, und das nicht nur für Frauenzimmer:
„Dein Leib, oh Mensch! Ist nur für dich gebaut,
Dir war er recht, dir war er anvertraut,
Und deinem Geist als Mensch darin zu leben,
Ist er von Gott nach weisem Rat gegeben.
Kein andrer Leib war so bequem für ihn,
Für ihn der best‘ ist ihm von Gott verliehn,
Und dächt’st du gleich ihn besser noch zu wählen:
Dein Witz ist falsch, dein Vorschlag würde fehlen“.
Es ist sogar richtig, dass das Versmaß hier ein wenig humpelt. Und Gott ist für das Argument nicht unbedingt nötig, Natur tut es auch, für alle, die damit besser arbeiten können. Der Gedanke aber ist – so sehr Johanne eigen wie die Form.
Nach ihrem vierzigsten Lebensjahr veröffentlicht Johanne keine neuen Gedichte mehr, obwohl sie erst 1782 sterben wird; sie kündigt das im Vorwort einer Neuauflage ihrer Sittlichen und zärtlichen Gedichte explizit an. Ein wohlwollender Kritiker schreibt daraufhin im Hamburgischen Correspondenten: „Wir und die Liebhaber ihrer Gedichte vernehmen diesen Entschluss ungern. Eine Frau, welche mit Männerstärke denkt, muss ein Muster der Nachahmung ihres Geschlechts sein und nicht so gleichgültig die Musen verlassen“. Eine Frau, die mit Frauenstärke denkt, darf aber eben das tun. Sie muss gar nichts, nur damit die Kritiker dieser Welt etwas zu kritteln haben. Männer (und Halle) hatten sie zur Autorin gemacht, ein wenig gegen ihren Willen. Aber wenn das Leben sie hat verstummen lassen, dann schweigt sie eben (Wittgenstein hätte es nicht besser sagen können).
Ein Unterschied
Man kann die Weltweisheit versteh’n,
Und doch noch nicht zu leben wissen:
Doch wer zu leben weiß, kann nie die Weisheit missen;
Sonst wüßt‘ er nicht die Kunst, mit Narren umzugeh’n.
Der Unterschied in dem, was diese zwei besitzen,
Ist leicht: Doch wen’gen nur bekannt.
Der Philosoph hat nur Verstand:
Doch der zu leben weiß, der weiß ihn auch zu nützen.
Literatur zu Johanne Charlotte Unzer:
Trinken die Mondbürger auch Wein? Philosophische Bemerkungen und scherzhafte Gedichte von Johanne Charlotte Unzer. Mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Jutta Heinz. kdp 2020.
Ursula L. Meyer: Philosophinnen Leben. Johanna Charlotte Unzer. Aachen 2018 (ausführliche, populär geschriebene Biographie mit zeitgenössischen Bezügen; enthält weitere Auszüge aus dem Grundriss einer Weltweisheit sowie ausgewählte Gedichte).
Thomas Gehring: Johanne Charlotte Unzer-Ziegler 1725-1782. Ein Ausschnitt aus dem literarischen Leben in Halle, Göttingen und Altona. Bern/Frankfurt a.M. 1973 (wissenschaftliche Annäherung an Person und Werk vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Philosophie und Dichtungslehre).


Comments: no replies