Wie viele Tode muss man gestorben sein, bevor man, endlich, wirklich sterben darf? Das ist eine Frage, die vermeintlich nur Romantiker stellen – also Menschen, die ihre Wahl zwischen Leben und Sterben längst getroffen haben: Nur der Tod kann die letzte und größte Sehnsucht von allen erfüllen, nämlich die nach Unendlichkeit, nach ewiger Fortdauer, nach dem Sieg des Geistes über das verrottende Fleisch; das Leben hingegen ist eine Reihe kläglicher Kompensationsversuche, eine schwache Vorübung, eine einzige Enttäuschung. Aber vielleicht stellen doch nicht nur Romantiker, die vom Leben allzu viel erwarten, diese Frage? Vielleicht sind es auch Menschen, die im Gegenteil vom Leben allzu wenig erwarten, die sich in gleichem Maße zum Tode drängen, am Tode hängen, also: Melancholiker, Depressive? Denn das Leben, im kalten Licht der Vernunft betrachtet, ist eine einzige Wiederholung: zu oft gesehen, nichts rührt sich mehr in einem, gar nichts, warum soll man empfinden, wenn man doch genauso gut sterben kann und endlich, endlich Ruhe haben vor den Zumutungen, die das Leben täglich stellt, Wiederholungen, Entscheidungen, Gefühle, alles Aufwand, sinnloser Aufwand, und wofür? So, wie es verschiedene Lebensarten gibt, gibt es auch verschiedene Todesarten. Man hat die Wahl (falls man, jemals, wirklich die Wahl hat).
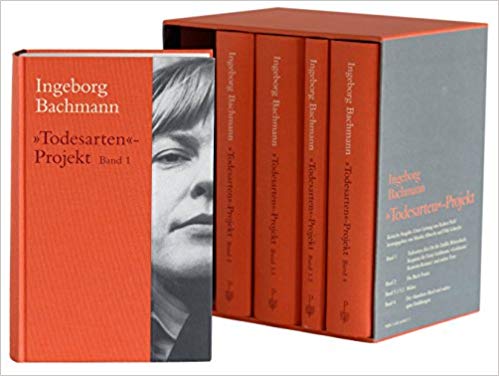
Ingeborg Bachmann war eine der letzten Romantikerinnen, zweifellos. In ihren ersten Gedichten schon beklagt sie, dass die Welt ihr nur eines einflößt: ein Lastbewusstsein, kein Selbstbewusstsein. Sie türmt Fragen über Fragen, häuft Klagen über Klagen, aber sie findet keine Antwort dazu, weder von Gott noch von sonst einer metaphysischen Instanz. „Ich frage“ – das ist ihre lyrische Kampfansage an die Welt, eine Variante des Zola’schen „J’accuse“: zwei Sätze ohne direktes Objekt, sie formulieren nur eine Haltung, eine Forderung, dass nämlich endlich Sinn sein soll, egal welcher: Sinn, Antwort, Bedeutung, nur so kann die Last des Lebens gestemmt werden, nur so ist Erhebung möglich (wenn Erhebung, jemals, wirklich möglich ist). Aber die Antworten bleiben aus. Obwohl: Die Liebe, natürlich, sie scheint eine Antwort zu versprechen: Und Ingeborg Bachmann, ein junges Talent aus Österreich, eine Denkerin und Dichterin von Jugend an, wirft sich ihr geradezu an den Hals. Mit sicherem Gespür wählt sie die intellektuellen Alpha-Wölfe ihrer Zeit, Dichter, Komponisten, Literaturkritiker; sie raucht die unvermeidlichen Zigaretten, sie trägt die unvermeidliche Perlenkette zum Kostüm und sie ist dabei, wenn die ganz Großen reden, denken, urteilen, so wie das Männer eben tun. Sie ist auch dabei, wenn sie sie dann verlassen, so wie das Männer eben tun. Aber immerhin, sie lebt ihre Freiheit, in Wien, Rom, Zürich, sie erhält die großen Literaturpreise (wenn auch nicht den größten, den Nobelpreis; aber sie wird wenigstens vorgeschlagen). Sogar der SPIEGEL setzt sie auf sein Cover, den weiblichen Popstar der Nachkriegsliteratur: Es ist ein wohlkalkuliertes Autorenbild, keine Perlenkettchen und Dauerwellen, sondern schwarze Kurzhaarfrisur und existentialistischer Rollkragenpullover, dazu ein androgyner Blick, sehr fern, sehr dunkel. Ist sie eine Frau oder ist sie ein Mann? Es scheint gleichgültig, in diesem Moment; sie ist eine Autorin, sie schreibt Gedichte, die beinahe so hermetisch sind wie die ihres Ex-Geliebten Paul Celan, aber dann doch – weiblicher, bildlicher, ohne auch nur eine Spur versöhnlich oder friedlich zu sein. Denn sie fragt immer noch, fragt und fragt, und sie ist immer noch keinesfalls zufrieden mit den Antworten der Welt. Aber zwischendurch scheint das Meer durch in ihren Gedichten, und man sieht Schiffe, die wagemutig in See stechen. Es gibt schwarze Pferde, gefährlich und kaum zu bändigen, die mit dem lyrischen Ich losstürmen, und wer sich nicht von Ingeborg Bachmann zu der Überzeugung erführen lässt, dass Böhmen doch am Meer liegt, manchmal, irgendwann, der ist für die Lyrik endgültig verloren. Sie kann sich in die Sprache retten, gelegentlich immerhin (wenn man sich, jemals, wirklich in die Sprache retten kann); aber am Ende bleiben es Worte, schöne Worte, Metaphern mit Mandelblüten, Delikatessen für den Connoisseur.

Reisen, Reisen, Männer, Männer, das Verlassenwerden. Krankheit, Depression, man findet keinen Schlaf mehr, auch nicht mehr mit Tabletten, kein Vergessen, keine Ruhe. Es wird ein endloser Kreislauf, kein Entrinnen ist mehr möglich. Und so wendet sich Ingeborg Bachmann den „Todesarten“ zu, ihrem letzten literarischen Projekt. Ein ganzer Zyklus sollte es werden, aber es blieben Fragmente. Eines nur ist vollendet, der Roman Malina, und er endet mit den lakonischen Worten: „Es war Mord“. Aber es ist nicht klar, wer genau tot ist; es ist auch nicht klar, wer der Mörder ist; es ist eigentlich überhaupt nichts klar in diesem Roman einer fatalen Dreierbeziehung zwischen Malina und Ivan und einer Frau, die „Ich“ heißt und keinen Namen hat: Sie ist, allerhöchstens, ein Konsonant, ein Mitlaut zwischen den beiden lauten, nur leicht variierten Selbstlauten A und I, Malina (und liest man nicht Anima, die Seele, mit?) und Ivan, und niemals, niemals bringt sie es in dem ganzen Text dazu, ein Selbstlaut zu werden, ein eigener Ton, eine eigene Erzählung. Und heißt doch „Ich“. Aber ist „Ich“ nicht der allgemeinste Name überhaupt, jenseits aller Identität und Persönlichkeit, für die ein einzelner Name steht? Und sind nicht die Frauen, die liebenden Frauen, genau solche namenlosen Wesen, die den jeweiligen Geliebten aufnehmen und sich in ihm spiegeln und seinen Namen annehmen? „Ich“ verliert sich in der Liebe. „Ich“ ist schon jung von diesem Dorn verletzt worden. „Ich“ ist Schneewittchen, aber Schneewittchen kann nicht mehr schlafen, sie blutet und blutet, rote Tropfen auf weißem Schnee, die Männer sehen nur ihre Schönheit, ihr schwarzes Haar und ihre roten Lippen, sorgfältig nachgezogen mit dem Lippenstift, aber sie sehen nicht, wie Schneewittchen stirbt, wie „Ich“ stirbt, weil es kein Selbstlaut wird. Und als, in einer anderen Erzählung von Bachmann (eine der wenigen mit einer weiblichen Sprecherin!), Undine ihr Abschiedslied anstimmt – Undine, eine Märchenfrau, verführerisch und tödlich für die Männer, die ihr verfallen, aber sie selbst bekommt nur eine Seele, wenn sie liebt, wenn sie ein Mitlaut wird, und wer mordet hier eigentlich wen? -, preist sie die Männer sogar noch ein wenig: Sie haben gut und viel gesprochen, von Motoren und Maschinen zum Beispiel; aber nicht vom Meer und Schiffen und wilden Pferden. Undine aber geht für immer; am Ende von Malina verschwindet „Ich“ in einer Spalte in der Mauer, und es heißt: „Es war Mord“. Und noch einmal: Wer war schuld an dem Mord? Oder ist das nicht die falsche Frage, die fatale falsche Frage des ganzen Jahrhunderts, immer nur: Wer war schuld? Waren nicht eigentlich alle Schuld, oder auch niemand, aber ganz sicher jeder und jede für sich selbst? Ich frage! Keine Antwort. Die Mauer schweigt. Undine ist gegangen.
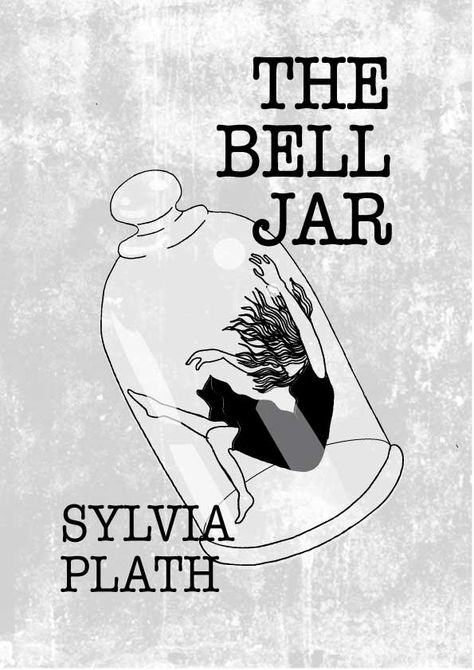
Sylvia Plath ist so etwas wie die amerikanische Variante von Ingeborg Bachmann, ihre Modulation vom Genre der hohen deutschen Literatur in das der etwas trivialen amerikanischen: ein College-Girl, mit Dates und Plänen und einem Boyfriend. Und sie will sogar eine Zeitlang leben, ganz normal leben – nachdem sie nämlich entdeckt hat, dass sie schreiben kann, wie Bachmann schon in ihrer Jugend. Zwar weiß sie auch bald, dass sie niemals Sekretärin werden will und Kurzschrift lernen (wozu Kurzschrift? Literatur ist das Gegenteil von Stenographie!) oder eine brave soccer mum in den Suburbs, aber sie versucht es mit dem Leben, eine Zeitlang, ganz ernsthaft. Geht nach New York, versucht es mit dem Schreiben und den Männern, es ist wie Sex and the City in Schwarzweiß, und sogar Freundinnen hat sie, gute und böse. Aber irgendwie, irgendwie funktioniert es nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte, die Welt des Glamours und der Autorschaft. Aber sie klagt nicht darüber, sie fragt auch nicht, oh nein, das ist nicht ihre Art. Sie macht einen Scherz daraus, einen bösen, aber gleichermaßen sehr, sehr lustigen Scherz; sie sieht die Welt zwar wie unter einer Glasglocke hervor, aber man kann lachen über das, was man da seltsam verzerrt jenseits der Glasglocke sieht, seht doch, ist es nicht komisch, wie sie sich alle abstrampeln, jeden Tag aufs Neue und doch immer das Gleiche, nur man selbst bleibt allein und sieht, wie komisch ist es, urkomisch, todtraurig, und warum soll man eigentlich noch aufstehen aus dem Bett, wenn alles am nächsten Tag sich wiederholen wird, urkomisch und todtraurig, eine einzige sinnlose Strampelei? Da hilft es nichts, dass sie alle ihre Möglichkeiten vor sich sieht, alles, was man werden könnte: Das Leben ist ein – und das Bild ist seltsam rührend und originell und unpassend zugleich – ein Feigenbaum, die Zweige streben alle noch oben, weit auseinander, und sie tragen Früchte, Werke oder Kinder. Aber wie soll man wissen, welches der eigene Zweig ist, wenn man doch alle Zweige haben will – oder keinen? Wie soll man sich überhaupt entscheiden, wenn es doch keinen Grund gibt, nichts, in dem man wurzelt, sondern nur beliebige Verzweigungen?
An diesem Punkt – und er liegt sehr viel früher als bei Ingeborg Bachmann, die wir noch auf der anderen Seite des Ozeans als Covergirl der Literatur flirten und rauchen sehen –, beginnt Sylvia Plath sehr konkret über Todesarten nachzudenken. Es gibt so viele Möglichkeiten sich selbst von diesem Leben zu befreien, das eben nicht zu wenig Möglichkeiten bietet, sondern zu viele, wie die Äste des Feigenbaumes, und an jedem Ende sitzen ein Tod und ein Leben. Und macht das überhaupt einen Unterschied? Bleibt nicht alles, Leben und Sterben, seltsam entfernt, gedämpft, unattached? Schauen einem, wenn man in den Spiegel schaut, nicht viel zu viele Gesichter an, jeden Tag ein anderes, und niemals stellt sich spontan die Empfindung ein: Das bin Ich! Denn Sylvia Plath ist, und man kann nicht genug betonen, wie klinisch und pathologisch und wie wenig eingebildet oder irgendwie psychosomatisch, nein, sie ist im Vollsinn des medizinischen Krankheitsbildes: depressiv; so wie ihre Mutter es war, so wie ihre eigenen Kinder es werden – ein Stoffwechselproblem im Gehirn, eine genetische Anlage, was auch immer, eine Ungerechtigkeit auf jeden Fall und doppelt fatal für eine Autorin. Denn eine Depression ist nicht etwa ein Leiden an zu viel negativer Emotion: Es ist ein Leiden an dem Fehlen jeglicher Emotion, eine erbarmungslose Rationalität, die die Wirklichkeit all der freundlichen Schleier entkleidet, mit der sie sich der „normale“ Mensch lebbar und verträglich macht: Positiv denken, es geht immer wieder bergauf, es gibt eine Lösung für alles und ein gutes Ende, und morgen ist auch noch ein Tag – oh nein! Es geht weder bergauf noch bergab, es geht immer im Kreis, und dafür gibt es keine Lösung, auch kein Ende, sondern nur das ewig Gleiche, die ewige sinnlose Wiederholung, und der nächste Tag ist die schlimmste aller Drohungen! Und ein Schmerz wäre so willkommen wie eine Freude, vielleicht noch willkommener; aber beides bleibt draußen, jenseits der Glasglocke, fremd, abstrakt, unattached.
Sylvia Plath nimmt es mit Humor, und zwischendurch zerreißt es einem das Herz, ihr dabei zuzusehen, in ihrem einzigen Roman, ihrer eigenen Geschichte, der Bell Jar, der Glasglocke. Man folgt einem Zweig des Feigenbaumes, man versucht es, wirklich. Man begibt sich in Behandlung, man versucht es (und die Ärzte wissen nichts, stellt sich heraus, sie können die Glasglocke nicht durchbrechen). Man bekommt sogar Kinder, dieses Wirklichste von allen. Nichts. Man schreibt Gedichte, ziemlich gute, und findet Anerkennung. Nichts. Man schreibt einen Roman, unter falschem Namen nichts, nichts, nichts. Der Mann ist schon länger fort, er hat einen betrogen. Nichts. Man versucht in der Wand zu verschwinden, die Glasglocke zu zerstoßen, Böhmen zu suchen, Todesarten, Selbstmordversuche, nichts, nichts, nichts. Bis es am Ende doch gelingt, vielleicht sogar aus Versehen, man wird es nicht mehr wissen. Sylvia Plath ist verschwunden, sie hinterlässt zwei Kinder, einen verzweifelten Ex-Ehemann und eine Reihe von Tagebüchern, die die Hölle auf Erden schildern, die Depression, Tag für Tag für Tag.
Vielleicht treffen sie sich, außerhalb der Wand und jenseits der Glasglocke, die beiden ungleichen Schwestern: die romantische Deutsche, die nicht aufhören konnte mit dem Fragen und die die Liebe niemals aufgab, auch wenn es immer die falschen Männer waren; und die zynische Amerikanerin, die sich kaltblütig zu Tode scherzte und das Wagnis eines Familienlebens auf sich nahm, auch wenn es nicht ihres war, sondern nur ein kleiner Zweig an einem belanglosen Baum, den sie selbst am Ende absägte. Und wenn sie sich gefunden haben, besteigen sie ihre wilden Pferde und ziehen nach Böhmen, das am Meer liegt, niemand wird sie finden dort, und ihre Werke werden einsam dastehen in der Weltliteratur, mutterlos und ohne Nachkommen, mit der Aufschrift: Mein Teil, es soll verloren gehen.


Comments: no replies