Ein Gastbeitrag von Emma Bohn
„ÄRGERT ES DICH IMMER NOCH, DASS ES 300 MAL SO VIELE ABHANDLUNGEN ÜBER DEN DEUTSCHEN WALD GIBT WIE ÜBER DEN DEUTSCHEN KOLONIALISMUS?“, fragt die Protagonistin sich in einem der vielen Selbstgespräche in 1000 Serpentinen Angst. Jedes Wort in Großbuchstaben, um es von der eigenen Antwort (in Kleinschreibung) abzuheben. Aber vermutlich auch, um diese und andere unangenehmen Fragen unumgänglich und konfrontativ in den Raum zu stellen. Dieser direkte Umgang mit dem Tabuthema Rassismus zeichnet Olivia Wenzels Debütroman aus. Die Autorin nimmt in ihren Schilderungen kein Blatt vor den Mund wie es ist, als Schwarze in der DDR aufzuwachsen. Besonders als weiße*r Leser*in fühlt man sich angesichts der unverhüllten Fremdenfeindlichkeit, die die Protagonistin erfährt, schockiert. Doch genau dieser Realitätscheck macht diesen Roman lesenswert.
Wenzel erzählt in ihrem autofiktiven Roman davon, wie sie versucht, tiefe seelische Wunden aus der Vergangenheit zu verarbeiten. Denn prägende Erlebnisse wie der frühe Tod ihres Bruders und die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter verfolgen sie bis in die Gegenwart. Hinzu kommt Rassismus als ständiger Begleiter. Von Kindesbeinen an diskriminiert und ausgegrenzt, hadert die Protagonistin mit ihrem Status als multi-ethnisches Kind einer deutschen Mutter und eines angolischen Vaters – und offenbart ohne jegliche Scham zutiefst persönliche psychische Abgründe. Von selbstzerstörerischen Impulsen bis hin zu berechtigter Wut über unsere intolerante Gesellschaft durchlebt sie dabei emotionale Extreme. Durch ihr eigenes Schicksal macht sie rassistische Missstände nahbar und konfrontiert den Leser selbst mit der unangenehmen Frage nach den eigenen Privilegien und der eigenen Mitschuld am heutigen Alltagsrassismus.
Wenzels Schreibstil ist ungeschmückt, direkt und umgangssprachlich. Insofern ist der Roman leicht zu lesen – die darin behandelte Thematik allerdings schwer zu verdauen. Doch diese paradoxe Mischung macht den Roman erst aus. Gerade weil Wenzels Schilderungen nicht durch aufwändige Stilmittel in einem schönen, abgemilderten Gewand daherkommen, hallen sie noch lange in den Köpfen der Leser nach. So beschreibt sie beispielsweise einen Badeausflug zum See mit ihrem damaligen – ebenfalls schwarzen – Freund. Plötzlich kommen Neonazis an den See, das Paar versteckt sich instinktiv vor ihnen, während die übrigen weißen Badegäste wortlos das Feld räumen. Zurück bleibt eine weitere schwarze Familie, deren Kind prompt zur Zielscheibe rassistischer Beleidigungen wird. Hin- und hergerissen zwischen dem Drang, helfen zu wollen und der Angst, am eigenen Leib rassistische Gewalt zu erfahren, ruft die Protagonistin erst später im Auto die Polizei. Wenzel zieht folgendes Resümee: „Rechter Terror ist: Ich denke bis heute an diesen Tag, an die Unmöglichkeit, mich korrekt zu verhalten. Rechter Terror ist: Ich schäme mich für meine Feigheit. Rechter Terror ist: Ich war auch mal diese Kind am See.“ Eindringlich, weil ihre Worte so direkt und schonungslos gewählt sind, beschreibt Wenzel in dieser kurzen Szene das Problem weißer Passivität, innerer Zerrissenheit als schwarze Zuschauerin sowie die ernüchternde Tatsache, dass Rassismus über mehrere Generationen hinweg nicht abgenommen hat.
Gleichwertig mit dem Thema Rassismus findet in dem Roman eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Thema Familie statt – in dem Fall der Protagonistin speziell um instabile, zerrüttete Verhältnisse. Sachlich und unberührt erzählt sie Anekdoten aus ihrer Kindheit, von einer kaltherzigen und vernachlässigenden Erziehung, die für sie Normalität war. Wie die Mutter die Kinder in einem Zimmer einschloss, um in Ruhe Renovierungsarbeiten nachgehen zu können oder wie genervt sie von ihrer Tochter war, als diese mit zwölf zum ersten Mal menstruierte und restlos überfordert damit war. Als Leser wirkt es auf einen so, als spiegele sich das schwierige und unnahbare Verhältnis zur Mutter auf literarischer Ebene in Wenzels sachlichem Schreibstil wieder. Gerade weil diese Vorkommnisse frei von jeder dramatischen Sentimentalität präsentiert werden, macht es sie authentisch und deshalb schockierend. Changierend zwischen Enttäuschung über die erzieherischen Defizite der Mutter und dem Willen, sich mit ihr auszusprechen, um Empathie für ihre Situation aufbringen zu können, schafft Wenzel eine Mutter-Tochter-Beziehung, die durch diese Ambivalenz realistisch wirkt. Auch hier findet sie prägnante Worte, um das grundlegende Verhältnis zwischen Eltern und Kindern im Allgemeinen zu definieren. So schlussfolgert die Protagonistin in einem ihrer Selbstgespräche über das eigene Kind, mit dem sie aktuell schwanger ist: „Lieben muss es dich, da hat es keine Wahl. Ob es dich mag, wird sich zeigen.“
Doch Wenzel stellt die Frauen im Leben der Protagonistin nicht einseitig als verbitterte Rabenmutter oder ignorante weiße Oma dar, auch diese zwei Schlüsselfiguren werden vielschichtig gezeichnet. So wechselt die Perspektive zeitweise von der autobiografischen Sicht hin zu Einblicken aus deren jeweiliger Lebensgeschichte. Insofern liebäugelt 1000 Serpentinen Angst mit dem Genre des Generationenromans, der in seiner klassischen Form ebenfalls drei Generationen derselben Familie umfasst. Dabei wird die Beziehung zwischen dem schwarzen Vater und der weißen Mutter thematisiert, in der das Paar Vorurteilen und Intoleranz trotzen müssen (muss). Auch die spätere Situation der Mutter als Alleinerziehende mit Geldsorgen macht deren Figur menschlicher. Des Weiteren wird durch die Einblicke der trostlosen Kindheit der Oma als Mädchen in der DDR, die aufgrund ihres Geschlechts Diskriminierung in der eigenen Familie erfährt, eine Parallele zur rassistisch-motivierten Diskriminierung der Protagonistin in ihrer Kindheit gezogen. Ob dieser Vergleich angebracht ist, wird allerdings genauso schnell hinterfragt, wie er gezogen wird.
Der Handlungsaufbau erschwert das Leseerlebnis leider oftmals, da nicht chronologisch erzählt wird. Die Protagonistin schweift oft ab und gelangt erst auf Umwegen zurück zum anfänglichen Thema. Dieser verworrene Gedankenfluss macht es schwer, ihr zu folgen. Unterbrochen wird er außerdem immer wieder von halbseitigen Einblicken in ihre Psyche, die in Form von bizarren, abstrakten Metaphern mehr Rätsel aufgeben, als dass sie Klarheit verschaffen. Hier legt Wenzel den direkten, knallharten Schreibstil ab, der andere Passagen so positiv herausstechen lässt. Neben diesen wirken derlei tiefenpsychologischen Exkurse ins Unterbewusstsein der Protagonistin schwächer.
Hinzu kommen die Selbstgespräche, die die Protagonistin in Gedanken mit sich führt. Minimale Struktur verleiht diesen die Orientierungsfrage „WO BIST DU JETZT?“, die sich im Verlauf mehrmals wiederholt. Dabei spaltet die Groß- und Kleinschreibung die Protagonistin visuell in zwei „Gesprächspartner“. Interessant daran ist, dass der groß geschriebene Part dem Gegenüber stets perfide und unangenehme Fragen stellt, es wird also eine Auseinandersetzung mit den eigenen aufdringlichen Gedanken erzwungen. Diese tiefgreifenden Passagen sind mit Abstand am Berührendsten zu lesen, es kommt darin zum Beispiel zu folgendem Austausch: „WILLST DU ETWAS BESONDERES SEIN? Nein. Meine ganze Kindheit lang war ich damit beschäftigt, nicht aufzufallen.“. Problematisch daran ist, dass die „Gesprächspartner“ zum Teil auf verschiedenen Wissensständen beziehungsweise in zeitlicher Entfernung zueinander stehen. Was der eine bereits erlebt hat, weiß der andere noch nicht. Dadurch fällt es selbst schwer, das Gelesene in Zeit und Raum zu verordnen.
Der Roman ist also eine Collage aus – teils nicht von der Protagonistin selbst stammenden – Erinnerungsfetzen und inneren Zuständen. Ob man diese Fragmente als rätselhafte Puzzleteile, die es in Eigenarbeit zusammenzufügen gilt, wahrnimmt oder als verwirrendes Erzählchaos, entscheidet maßgeblich über den eigenen Lesegenuss.
Nichtsdestotrotz trifft Wenzel mit ihrem Roman präzise den Nerv der Zeit, da der aktuell stattfindende Aktivismus der „Black Lives Matter“-Bewegung in ähnlich rechtschaffener, direkter Manier auf Rassismus hinweist wie Wenzel es durch ihren persönlichen Erlebnisbericht tut. Sie lässt sich bis zum Ende nicht erweichen, denn der Schluss ist weder genugtuend noch versöhnlich, stattdessen sprengt sie das gesamte Narrativ binnen weniger Seiten durch selbst eingeräumte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Erzählerin. Dieser letzte literarische Schlag ins Gesicht lässt den Leser mit vielen Fragen zurück. Fragen wie „WÄRST DU ERLEICHTERT ODER VERÄRGERT; WENN ICH MIR DIE HÄLFTE ALLER RASSISTISCHEN ERFAHRUNGEN AUSGEDACHT HÄTTE? […] VOR ALLEM ABER FRAGE ICH DICH. BEGREIFST DU […] DASS ALLES, WAS ICH DIR ERZÄHLE, IN EIN EINZIGES LEBEN PASST UND DASS DIESE LEBEN DENNOCH EIN GEWÖHNLICHES UND GUTES IST?“
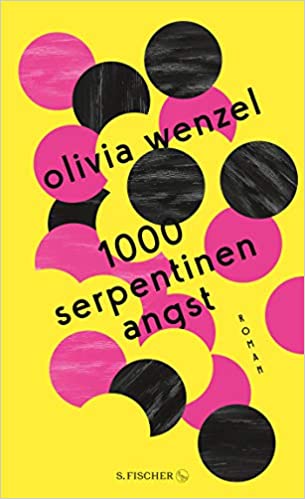
S. Fischer Verlage
https://www.fischerverlage.de/buch/olivia-wenzel-1000-serpentinen-angst-9783103974065


Comments: no replies