Wolfram Eilenberger: Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933-1943. Stuttgart 2020.
Natürlich musste das Buch anders geschrieben werden als sein Vorgänger „Zeit der Zauberer“ über vier männliche Meisterdenker des 20. Jahrhunderts (Benjamin, Cassirer, Heidegger, Wittgenstein), Frauen denken ja schließlich auch anders. Aber musste man es wirklich so sensationsheischend „Feuer der Freiheit“ nennen (wahrscheinlich ist der Verlag schuld, genauso wie an Zeit der Zauberer“, das ursprünglich und nach der Intention des Autors „Explosion des Denkens“ hätte heißen sollen; aber wären nicht „Zelte der Zauberinnen“, oder besser noch „Denkende Hexen“ auch schöne Titel gewesen?)? Und natürlich, die Zeiten waren maximal dunkel zwischen 1933 und 1943; wir sind nicht mehr im großbürgerlich-intellektuellem Milieu der vier Zauberer, die zudem alle gesegnet waren mit einem ziemlich großen Ego. Die beiden Simones jedoch, die die Russin Alissa, die sich „Ayn“ nannte, und die immer etwas sanft schauende Hannah – ach, sie hatten Egos, aber wie mühsam ist es ein weibliches Ego zur vollen Blüte zu entfalten? Immer sind da doch die Männer, mal sind sie am Rande, mal sind sie im Bett, mal sind sie im Weg (meistens). Na gut, die eine Simone (Weil) macht sich so energisch von der Jüdin wider Willen zur Heiligen, dass sie am Ende ihr Ego im wörtlichen Sinne aushungerte. Und Ayn Rand, die große Außenseiterin, die vielfach Beschimpfte, Verleumdete – und doch so viel Gelesene: Ihre Männer waren nicht nur in ihren Romanen amerikanische Superhelden, warum machte sie nicht eine Frau zur Superheldin; neben Atlas shrugged stünde Athene yawned? Die andere Simone (Beauvoir) schließlich, sie war von Anfang an nicht denkbar ohne den „Anderen“, ihren Lebenspakt-Partner, dem doch ziemlich dominanten, wenn auch körperlich eher kleinem Sartre, und hat er es ihr gedankt? Athene yawned. Hannah Arendt schließlich, die geheime Affäre mit Heidegger, jahrelang, wann wird sie endlich ihre eigene Stimme finden?
Immerhin schreibt Wolfram Eilenberger seiner vierköpfigen girl group (man könnte vier Pilzköpfe aus ihnen machen, aus den Jugendfotos, mit sehr ernsthaft blickenden jungen Frauen) wenigstens die „Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten“ zwischen 1933 und 1943 zu, dessen Vorspiel sozusagen die „Zeit der Zauberer“ war, 1919 bis 1929, das „große Jahrzehnt der Philosophie“; man könnte aber auch aus der Abfolge herauslesen, dass die „großen Männer“ die Philosophie in solche Schwierigkeiten gebracht hatten, dass sie mal wieder nur die Frauen retten konnten. Gedankt hat man es ihnen wenig, danach übernahmen wieder die Männer. Was bleibt sind Schneisen, so der Titel des letzten Kapitels. Bald würden sie wieder zuwachsen, überwuchert von den nachfolgenden Meister-Denkern, und nur hier und da können sich einzelne Begriffe retten, die sich untrennbar mit einem Frauennamen verknüpft haben (was, ähnlich wie im Periodensystem der Chemie oder bei der Benennung mathematischer Formeln, die einzige Chance auf beinahe-ewigen Ruhm ist: den Namen an ein Phänomen zu hängen; eines reicht schon, und es bekommt ein ewiges Copyright): Wer Hannah Arendt sagt, muss „die Banalität des Bösen“ sagen (für Fortgeschrittene: „Natalität“, beide Konzepte werden übrigens interessanterweise nicht erwähnt im Buch). Wer Simone de Beauvoir sagt, muss „Zur Frau wird man gemacht sagen“ oder „das andere Geschlecht“(das Buch führt sie jedoch kaum ein als Vordenkerin des Feminismus bis heute). Wer Ayn Rand sagt, muss entweder Atlas shrugged sagen oder „böse“, „kapitalistisch“, „faschistisch“, sie hätte aber eher mit den Schultern gezuckt. Simone Weil hingegen, die ultimative Außenseiterin in dieser girl combo von Außerseiterinnen, hat es nicht zu einer Formel gebracht; zu religiös, zu mystisch, zu radikal. Ihre Waffe war nicht so sehr ihr Wort, sondern das eigene Leben, das sie am Ende auch konsequent aufgab, indem sie sich mehr oder weniger zu Tode hungerte.
Nun ist die Idee einer vervielfachten Parallelbiographie zweifellos charmant, war sie es schon bei den Zauberern Benjamin, Cassirer, Heidegger und Wittgenstein. Und allein die Überschriften der Kapitel samt ihren lakonischen Untertiteln und dem komischen Subtext im rhetorischen Zeugma geben eine ganz eigene Zusammenfassung der unterschiedlichen Entwicklungen: „Beauvoir ist in Stimmung, Weil in Trance, Rand außer sich und Arendt im Alptraum“ (Kap. 1: Funken); „Rand zieht es zum Broadway, Beauvoir zu Olga, Weil in die Fabrik und Arendt nach Palästina“ (Kap. III: Experimente); „Weil findet Gott, Rand die Lösung, Arendt ihren Stamm und Beauvoir ihre Stimme“ (Kap. V: Ereignisse). Ein Zeugma, das ist eine rhetorische Figur der Knappheit, der eingesparten Worte: Eingespart wird nämlich das Verb, das gewöhnlich ja in jedem Satz die Hauptrolle spielt; es bekommt auf einmal viele Substantive, denen es dienen muss: Denn „finden“ kann man eben genauso gut Gott wie eine Lösung, eine Fabrik oder ein Land. Es ist das Finden, auf das es ankommt; Substantive sind austauschbar. Und so werden die vier Frauen in ihrer Herkunft von verschiedenen geistsprühenden „Funken“ berührt; sie erleben unterschiedliche „Exile“; sie machen ihre eigenen „Experimente“; sie suchen und finden (oder finden keine) „Nächste“; sie alle werden wieder eingeholt von „Ereignissen“ und Opfer von „Gewalt“; schließlich jedoch erobern sie sich ihre „Freiheit“ und entzünden am Ende dasjenige „Feuer“, dass der Titel und der anfängliche Funke versprochen haben – bevor ihre Schneisen dann, epilogartig, verwuchern. Sind es exemplarische Lebenslinien, ist daraus eine Art philosophische Lebensform abstrahierbar, ein großes Zeugma aller Denkenden? Oder nur der weiblichen unter ihnen, die besonders leicht entzündbar sind, während Prometheus an ihnen vorbei das Feuer erfindet, sehr aus sich selbst, ein Muster-Ego des Männlichen?
Parallelen und Unterschiede, das ist es, was eine gute Parallelbiographie ausmacht, schon bei Vater Plutarch. So ist die große parallele Linie in Feuer der Freiheit gut erkennbar, und es sprühen so viele einzelne Gedankenfunken durch die Kapitel (manche gehören den denkenden Frauen, einige dem Autor), dass für Unterhaltung eigentlich durchgängig gesorgt ist. Die Unterschiede hingegen – müsste man da nicht doch gelegentlich etwas tiefer ins philosophische Fleisch schneiden, bei aller Rechtfertigung der Nähe von Philosophie und Leben, zumal in dunklen Zeiten, und wenn sie von den Autorinnen selbst (in unterschiedlichem Maße) programmatisch vertreten wird? Natürlich lesen sich Lebensgeschichten besser und leichter, aber zwischendurch beschleicht die Leserin doch der Verdacht, dass gerade die leiblichen Beziehungsgeschichten eine Tendenz haben, das eigentliche Denken in den Hintergrund zu drängen; Texte werden nur gelegentlich herbeizitiert, aber eher im Überflug. Beauvoirs umfangreiches autobiographisches Werk beispielsweise wird ebenso wenig eingehender erwähnt (es ist nicht primär philosophisch, zugegeben, aber wenn man Leben und Philosophie doch eigentlich nicht trennen will oder kann?) wie ihr knappes literarisches; Das andere Geschlecht, das nicht weniger ist als eine umfangreiche, gehaltreiche Enzyklopädie der Weiblichkeit und ein zentraler Text für den gesamten Feminismus, erhält kaum ein paar Absätze. Der Eindruck drängt sich auf, dass der Autor – zu wenig verliebt in seine Hauptfiguren ist; vielleicht flaniert er doch lieber mit Walter Benjamin durch Paris oder ergeht sich mit Wittgenstein und Heidegger im Gebirg, als mit Simone Weil in die Fabriken zu gehen oder mit Ayn Rand an den Broadway. Aber immerhin, Ayn Rand, das ist auf jeden Fall lobend hervorzuheben: Eilenberger hält Ayn Rand nicht nur aus, nein, er hat sie erwählt und schafft es sogar, ihre nicht direkt unumstrittene Philosophie halbwegs objektiv wiederzugeben und nicht dem Bannfluch zu unterziehen, unter dem sie seit Jahren und Jahrzehnten steht (Athene yawned, aber es fiel ihr nicht leicht). Rand ist bei Eilenberger nicht das Faschistisch-Böse, sondern eben eine Antipodin des Denkens, und wer meint, dass man nicht gelegentlich eine ordentlichen advocata diaboli braucht, hat sich einfach zu kuschelig eingerichtet in seiner Echokammer und ist immun geworden gegen jegliche Provokation des Denkens. Derweil gilt Ayn Rands Atlas shrugged neben der Bibel als das seit den sechziger Jahren meistverkaufe Buch in den USA; eine Parallele, die einen allerdings ein wenig misstrauisch machen könnte; denn wohl kaum werden alle diejenigen, die eine Bibel erstehen, diese auch lesen, von Buchstabe zu Buchstabe, oder gar den Geist erfassen.
Und lesen muss man die Werke sowieso selbst, egal ob männliche Zauberer oder weibliche fire fighter. Feuer der Freiheit ist mehr ein Rahmen, ein Kontext, eine Zeit-Geschichte; gelegentlich: eine Geschichte des Weiblichen (und man wünschte dann doch, heimlich und gelegentlich, eine Frau hätte das Werk geschrieben; mehr sym-pathisch). Aber Wolfram Eilenberger hat seinen Namen an das Muster „Philosophen-Quartett“ geheftet, und es sei ihm gegönnt, zumal er sich wirklich auskennt und amüsant schreibt und erfrischend unvoreingenommen denkt. Fortsetzungen sind zu erwarten: Vielleicht Theodor W. Adorno, John Rawls, Michel Foucault, Jürgen Habermas, „Im Dickicht der Diskurse?“; oder: Martha Nussbaum, Judith Butler, Peter Sloterdijk, Giorgio Agamben, ein gemischtes Doppel unter dem Titel „Im Angesicht des Anderen“? Es ließen sich auch globalisiertere Varianten denken, wenn man den doch ziemlich alteuropäischen Kanon verlässt; aber nicht jeder Rahmen hält es aus, so weit aufgespannt zu werden. Wir warten jedenfalls mit Spannung auf die Fortsetzung.
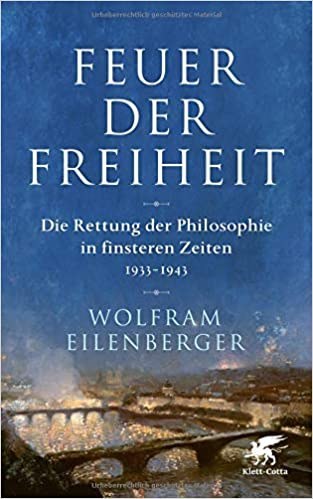
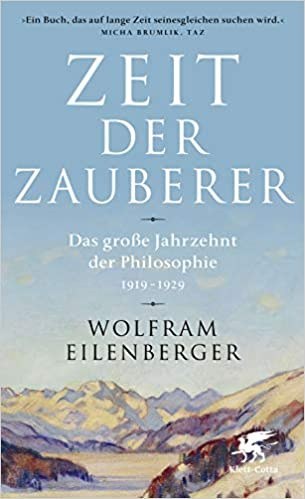
Philosophieflüstereien, oder: Sanfte Disruptionen
Wolfram Eilenberger: Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929. Stuttgart 2018.
(geschrieben im Anschluss an einen Vortrag Wolfram Eilenbergers in Freiburg, Dezember 2018)
Schon wieder ein Freiburger. Die philosophische Welt besteht aus geborenen Freiburgern, denen man die gute Schwarzwaldluft auch Jahrzehnte später noch ansehen kann und das Springende der Bächlein; es ist immer ein wenig die Rückkehr des verlorenen Sohnes, und man schlachtet ein kleines akademisches – nun, wohl nicht Lämmchen, sondern Pfännchen (im Anschluss an die Veranstaltung jedenfalls), wohlgefüllt mit Spätzle, und trinkt einen badischen Wein dazu, von der Sonne verwöhnt. Diesmal ist es sozusagen sogar ein doppelter Freiburger, denn der Referent spricht auch noch, unter anderem, von dem trotz allem berühmtesten Freiburger Philosophen. Man sieht es ihm an, dass er selbst ordentlich mitgenommen ist von der Vorstellung, ziemlich genau hundert Jahre später als Heidegger-Wiedergänger aufzutreten, auch wenn das Schwarzwäldlerisch-Wettergegerbte nicht ganz bergbubenmäßig geraten ist und von einer wohligen Rundlichkeit überzeichnet. Aber zweifellos ist Wolfram Eilenberger, wie seine vier „Zauberer“, die er uns heute präsentiert, ein gestandener Philosophieflüsterer. Sein sanftes Timbre trägt auch über die ein oder andere Respektlosigkeit, und die Einführung als – nicht nur soeben preisgekrönter Autor eines philosophischen Sachbuchs und Hansdampf auf allen philosophischen Kanälen –; nein: als stolzer Besitzer einer DFB-Trainerlizenz hat ihm sowieso den Rest des Publikums (das männliche, also) gewonnen. Die Versuchung, lieber doch über Fußball zu sprechen, wird den ganzen Abend über dem Saal schweben, zumal unser Referent sogar in dem preisgekrönten Buch die Frech- oder Freiheit (von Flapsigkeit spricht ein anwesender Lektor etwas streng) besessen hat, ein Redematch zwischen Cassirer und Wittgenstein in der luftigen Höhe von Davos im Stil eines Sportreporters darzubieten – was, wenn man der Flapsigkeit mal nicht unter den verführerisch erhobenen Rock, sondern ins Gesicht schaut, der Sache und dem Stil nach angemessen war; wahrscheinlich war es ein klassischer philosophischer Hahnenkampf, und die Kämme werden sehr geschwollen gewesen sein.
Zeit der Zauberer also – die Leserin sieht im Hintergrund zusätzlich Thomas Mann auftauchen, den Wortzauberer und Zeitflüsterer schlechthin, wie er sich in Davos sorgfältig neben seiner kurenden Gattin in die Decke wickelt und ein paar gestochen scharfe und gleichzeitig hinreißend flapsige Sätze über Naphta und Settembrini aufs Papier zaubert. Beide verwandeln sich unter der Hand in Heidegger und Benjamin, den Seins- und den Passagenflüsterer, und gäbe es eine Art Bedeutungsgeigerzähler bei diesem Gespräch, er würde jetzt in die Höhe treiben wie das Fieberthermometer der lungenkrank dahinsiechenden Liegenden. Zeit der Zauberer, das gibt unser Philosophieflüsterer jedoch im Verlauf des Abends zu, war eigentlich eine Erfindung des Verlags. Sein eigener Arbeitstitel sei gewesen „Explosion des Denkens“; das aber, so der Lektor, sei ein eindeutig männlicher Titel, nun sei es aber leider so, dass Bücher von Frauen gekauft würden. Dem Argument kann man sich bei aller politischen Unbotmäßigkeit schlecht entziehen, weil es die zahlenbewehrte Realität auf seiner Seite hat (und wünschte man sich das nicht gelegentlich auch in luftigen philosophischen Diskussionen, einen Realitäts- statt eines Bedeutungsmessers mit einer weiten Skala von „wirklich wahr“ über „relativ wahrscheinlich“ und „interessante Möglichkeit“ bis hin zu „vollständig und noch dazu schlecht ausgedacht“? Ach, man wird doch träumen dürfen, wenn man schon nicht zaubern kann!). Zeit der Zauberer war also die Damenwahl, vielleicht gemeinsam mit dem sanft cremefarben daherkommenden Cover; und man kann einmal mehr studieren, dass die Hülle eben nicht doch nur eine beliebige Verpackung ist um den eigentlichen Kern, sondern dass sie den Kern natürlich ausformt: Denn würden wir das gleiche Buch jetzt noch einmal lesen, unter dem Leitgedanken „Explosion des Denkens“ und mit einer martialischen Kriegskulisse im Hintergrund – wäre es nicht sofort ein viel männlicher, ein viel energischeres, ein viel revolutionäres Buch geworden?
Wir jedoch nähern uns dem Werk zunächst aus dem Blick des Zaubererdompteurs, der beharrlich flüsternd immer neue Bilder anbietet: Vom „Zelt des Denkens“ spricht er, das die vier Zauberer in den 20er Jahren errichtet hätten und das noch heute einer eher in heruntergekommenen Altbauten dahinvegetierenden akademischen Philosophie einen Zufluchtsort biete, näher an den Sternen und an den Elementen. Von den Denksprüngen spricht er, den, ja, sagen wir es ruhig: Disruptionen (und schon nähert man sich wieder dem Explosionsfeld!), die die vier Zauberer der kantischen Philosophie und ihren doch vermeintlich so unerschütterlichen Fundamenten zugefügt hätten – jeder auf seine eigene, ziemlich unvergleichliche Art und Weise, doch in Einigem, Wenigem, aber vielleicht Entscheidendem übereinstimmend: Der Mensch sei, und hier springe Kant samt seinen Nachfolgern einfach zu kurz, vor allem ein sprechendes Wesen. Wenn eines schönen Tages irgendein Außerirdischer aufgrund eines intergalaktisch unwahrscheinlichen Zufalls auf unsere schöne Erde kommen würde und am zweiten Tag Bericht erstatten müsse an seine fernen Oberen, dann würde er höchstwahrscheinlich sagen: Sie reden, den ganzen Tag lang (wenn es ein besonders kluger Außerirdischer wäre, würde er außerdem wahrscheinlich im zweiten Satz sagen: Und dabei verstehen sie sich nicht einmal!).
Denn das ist es, was unsere vier Philosophenzauberer, Heidegger, Wittgenstein, Cassirer und Benjamin also, vereint bei allen Differenzen in Outfit und Lebensweg: Sie reden dicke Bücher lang vom Wesen des Menschen und vom Wesen der Sprache, und kein Mensch versteht sie. Daraus ziehen sie, und das sagt uns unser Zaubererdompteur ein wenig verschmitzt, eine ziemlich philosophische Konsequenz: Sprache sei nämlich gar nicht für Mitteilung gemacht (eine Erfahrung, bei der der Realitätsmesser übrigens ziemlich weit ausschlägt in Richtung „wirklich wahr!“)! Sie sei vielmehr Offenbarung, spreche für sich selbst und allenfalls ein wenig von der Existenz, zeige bestenfalls etwas, im Modus der Darstellung des Vorweisens. Verständigung? Ach, wer doch daran glauben könnte. Die vier Zauberer tun es nicht. Sie sind Einsame, sind es im Schwarzwald wie in Cambridge, als Volksschullehrer wie als Hochschulprofessor, als Jude wie als übergelaufener Katholik. Man kann vielleicht sagen mit einer gewissen Aussicht auf Übereinstimmung: Es gibt Frauen (meist zu viele und gelegentlich die falschen), es gibt Kollegen (immer die falschen), es gibt Konkurrenten (mit denen könnte man reden, fast immerhin); aber es gibt keine eindeutigen, verständlichen, handzahmen Antworten auf philosophische Fragen. Als ob es auf eine Offenbarung eine Antwort geben könnte! Nein, die philosophische Sprache taugt höchstens als Leiter; Kant hat ein paar Stufen gezimmert, Hegel den ganzen Mittelteil, und schon Nietzsche war eher damit beschäftigt an ihr zu sägen. Die eigentliche philosophische Reifeprüfung aber, so Wittgenstein, ist: die Leiter wegzuschubsen, wenn man oben ist. Das ist der Sprung ins wahre Denken und Sprechen. Es gibt dann aber keine Rückkehr mehr.
Die aufs Podium geladenen akademischen Kollegen, die eigentlich unter der Macht der Explosion etwas erschüttert hätten aussehen sollen, finden zustimmende, gelegentlich preisende Worte. Man sieht sie nicht direkt dabei, wie sie die Leiter wegschubsen; aber sie lassen sich auch nicht dabei erwischen, wie sie sich an den Sprossen festklammern. Während die Diskussion nur schwach in Gang kommt, ertappt man sich selbst dabei, wie man darüber nachgrübelt, ob das Versagen der Sprache als Medium der Mitteilung und Verständigung nicht besonders für Philosophen gilt, diese in besonderem Maße sprachbehafteten Wesen: Ständig verlangt man von ihnen, sie mögen sich mitteilen, reicht es denn nicht, dass sie mit ihren Schülern sprechen, mit sich selbst und gelegentlich mit einer ganzen Herde ziemlich schwerverständlicher historischer Autoren? Weiß man doch nicht einmal, ob andere Menschen als Vernunftwesen überhaupt existieren, man könnte ja umgeben sein von einer Herde tückisch programmierter Roboter, die ständig so tun, als würden sie philosophische Begriffe verstehen, philosophische Texte lesen und überhaupt irgendwie interessiert sein an philosophischen Fragestellungen? Ist es nicht wichtiger, dass man selbst die schönsten Sprünge für sich machen kann, „immer radikal, niemals konsequent“ (Eilenberger über Benjamin)? Denn der Meister ist, das macht uns unser Philosophieflüsterer nun klar, immer ein Kannibale: Er zehrt von seiner Umwelt, sie ist ihm das Material, der Stoff, die Materie, die Empirie, die lästig-überlästige, aber doch so notwendige, das Sprungbrett für den freien Geist. Meister sind nicht sympathisch, Artisten scheren sich nicht um die durchschnittliche Sprungkraft einer demokratischen Masse. Die Disruption wächst da, wo die comfort zone aufhört; und wer sich brav an die Schilder hält (Vorsicht! Freie Gedanken! Hier endet der mainstream!), wird niemals Sprengkraft entfalten können.
Und nun, sanft gestupst und gepiekst auch aus dem Publikum, schimpfen manche auf dem Podium doch ein wenig auf die akademische Philosophie, in der der deutsche Professor – das freieste Wesen von allen, sofern er einmal seinen Lehrstuhl erobert hat und natürlich nicht daran denkt, ihn wegzustoßen – Dienst nach Vorschrift tut und nicht daran interessiert ist, gelegentlich einen befreienden Sprung zu tun (er ist damit aber auch nur eine Variante des modernen Menschen, der, nachdem er sich von allen äußeren Ketten von Religion und Herrschaft befreit hatte, nichts Besseres zu tun hatte, als sich möglichst schnell schicke neue zu kaufen). „Zu sinnlos, um falsch zu sein“ – das war das Wittgensteinsche Verdikt über einen Großteil der konventionellen Philosophie, und während man noch über die pointierte Zuspitzung lacht, sticht einem das Messer schon von hinten in den Rücken: Et tu, Brutus? Heute schon gesprungen? Derweil schweben weitere Zuspitzungen durch den Raum, Helene Fischer kämpft sich „atemlos durch die Nacht“, und der Referent erklärt uns, genau das sei der eigentliche philosophische Impetus gewesen, von Anfang an, am Ursprung: Die Menschen laufen durch das Leben wie durch eine fremde, verwinkelte Stadt, es ist Nacht, sie sind außer Atem, aber sie suchen nach Orientierung, oh wie verzweifelt versuchen sie zu verstehen! Was sie aber finden, sind Berge von Kartoffelbrei. Zermanschter Sprachbrei, formlos, gelegentlich ein Klümpchen, immer zu wenig Salz und zu sparsam mit der Butter. Atemlos durch die Nacht – profanisieren müsse man die Philosophie heutzutage wieder, sie befreien aus der Verbreiung des akademischen Denkens, seiner Verarmung, Verengung, Versumpfung durch die teuflische Dreiheit von Veröffentlichungsdruck, Drittmittelhysterie und akademisch domestizierten Gedenke im Gestell! Vielleicht könnte man dann wenigstens wieder sinnvoll genug werden, um – falsch zu sein (das sagt er aber nicht, dazu ist er zu klug).
Und so sehen wir, der Abend ist inzwischen zu einer zweiten Veranstaltung fortgeschritten und dem Referenten werden nun wahrhaft sportliche Leistungen abverlangt, Heidegger und Wittgenstein am Fenster. Es ist 1919, die Welt ist in der Krise, die Nation ist in der Krise, die Familien sind in der Krise, und die Philosophie – gedeiht in der Krise, so Eilenberger. Natürlich sagt er damit auch, dass die derzeitige Philosophie Grund zum Gedeihen habe, aber vielleicht ist die Krise dann doch noch nicht ganz krisenhaft genug, um den Wohlstandsbauch und das akademisch rund gefütterte Denken zum Grimmen zu bringen, und die Fenster sind gerade schalldicht erneuert und frisch gestrichen worden (zu öffnen gehen die meisten seit langem nicht mehr, zu gefährlich, jemand könnte springen). Heidegger und Wittgenstein jedenfalls sind wohl an ganz anderen Fenstern gestanden, damals, im September 1919, auf dem Höhepunkt einer sehr realen weltweiten Krise. Wittgenstein war aus dem Krieg zurückgekommen und begab sich energisch daran, alle Leitern wegzustoßen: Er verteilte sein sehr erhebliches Vermögen an die Familienmitglieder und begab sich als Volksschullehrer in die Berge. In der Familie sprach man, so berichtete die Schwester, gern in Bildern und Vergleichen; und sie verglich diese Idee ihres Bruders mit der Vorstellung, ein Präzisionsinstrument zum Öffnen einer Kiste zu verwenden. Wittgenstein hingegen beschrieb seine eigene Situation mit der eines Menschen, der an einem Fenster schaue; er sehe nicht, dass draußen ein Sturm wüte, und wundere sich deshalb über die seltsamen Bewegungen der Menschen auf den Straßen. Heidegger schließlich braucht noch nicht einmal einen Sturm, um sich grundlegend entfremdet von den Menschen zu fühlen; in einem Brief schreibt er, ziemlich zur gleichen Zeit: „Ich bin dann schon beim Problem des Verkehrs überhaupt, das mich dieser Tage besonders beschäftigte, wo ich neue Menschen kennengelernt habe. Und ich merke: Sie sind mir im Grunde alle gleichgültig – gehen außen vorbei wie am Fenster – man sieht ihnen nach und erinnert sich vielleicht mal wieder“. Vielleicht aber auch nicht. Man kann die Fenster auch ganz schließen, blickdicht, Verdunkelung ist angesagt. Zurück in die blackbox. In die Höhle. Lasst sie weiterplappern, draußen, im Verkehr, lasst sie zappeln in unsichtbaren und unerheblichen Stürmen. Immerhin läuft Helene Fischer dort atemlos durch die Nacht. Es wird gelegentlich Fußball gespielt, wenn auch nicht mehr montags, hier und dort ist sogar jemand disruptiv und erfindet ein neues sensationelles Unterhaltungsgestell für die Massen. Und wenn man ihnen sagte, dass sie nicht verstünden, würden sie nicht verstehen. Dabei ist es gar keine Zauberei.


Comments: no replies