Gedanken zu Irmgard Keuns wenig beachteten Roman Kind aller Länder (1938)
Die Protagonistin von Irmgard Keuns 1938 erschienen Roman ist das zehnjährige Mädchen Kully, das sich selbst als Weltbürgerin versteht. Als ‚Weltbürger‘ bezeichnet man „jemanden, nach dessen Anschauung alle Menschen gleichwertige und gleichberechtigte Mitglieder einer die ganze Menschheit umfassenden Gemeinschaft sind und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation von untergeordneter Bedeutung ist“ (Duden). In einer Zeit kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wirkt diese Haltung aus heutiger Sicht besonders mutig.
Aus Deutschland geflohen, kämpft Kully mit ihren Eltern in verschiedenen Ländern entweder ums nackte Überleben oder badet im Luxus. Ihr Leben ist ein Auf und Ab zwischen Hungern und Sterneküche. Sie ist eine „Luxus-Emigrantin“, wie ihr ein Freund bescheinigt: Schließlich seien sie und ihre Eltern keine richtige Emigranten, sie seien ja noch nicht einmal Juden. Kullys Vater ist ein deutscher Schriftsteller, der wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem NS-Regime aus Deutschland fliehen musste. Frau und Kind nahm er mit. In der Ferne leiht er sich Geld bei ausländischen Verlagen, seinen Arbeitsaufträgen kommt er aber nicht nach. Als Lebemann und Casanova verprasst er das Geld, wenn er es besitzt – dann gönnt er sich und seiner Familie Champagner und Kaviar. Das Geld reicht nie lange aus und so muss die Familie nach wenigen Tagen statt kostspieligen Restaurantbesuchern wieder von der Hand in den Mund leben – allerdings stets untergebracht in teuren Luxushotels. Diese Art zu leben, führt die Familie in einen absurden Teufelskreis: Um den Gläubigern das Geld zurückzugeben, muss erneut Geld geliehen werden. Findet sich niemand, haut Kullys Vater ab oder lässt seinen Tod verkünden. Und so kommt es, dass meistens Kully und ihre Mutter das fehlende Geld durch Schmeicheleien und Lügen besorgen müssen, während sie gleichzeitig vor den Portiers und der Hoteldirektion flüchten, die auf eine Bezahlung der Hotelrechnung bestehen. Es entstehen komische Situationen, die einen beim Lesen auflachen lassen. Irmgard Keun schafft es mit ihren Schilderungen und ihrem naiven Sprachstil, Verzweiflung ertragbar zu machen und einer noch so ausweglosen Situation etwas Komisches abzugewinnen. Die Autorin beweist auch in diesem Buch aus dem Jahr 1938: Sie ist eine große Humoristin.
Der Roman wird getragen von der leichten Sprache der 10-Jährigen Kully, die aus der Ich-Perspektive ihren Blick auf die Welt schildert. Sie entlarvt die Schwächen und Stärken ihrer Mitmenschen, beobachtet ethnisch-kulturelle Unterschiede und changiert in ihrem Agieren von frech bis liebenswürdig. Kully spricht fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Niederländisch. Sie findet schnell Anschluss und hat trotz ihrer jungen Jahre ihren eigenen Kopf: Mein Vater war furchtbar streng. Er sagte, die ganze Familie werde durch mich untergehen und ich müsse doppelt und dreifach artig sein, um mich in ein fremdes Land gut einzuführen. Ich weiß aber, dass man sich als Kind viel besser in ein fremdes Land einführt, wenn man nicht so furchtbar artig ist. Das können die Erwachsenen natürlich nicht wissen, weil sie ja nie mit fremdländischen Kindern spielen. Kullys Leben ist ein Abenteuer – ein Abenteuer ohne Heimat. Den Verlust der Heimat versucht sie mit einem Gefühl von Freiheit zu kompensieren. Ihre Analysen und Schlussfolgerungen kommen einfach daher und geben dem Lesenden doch viel Raum zum Nachdenken. „Wir sind in die allgemeine Heimat gewandert. Nach Deutschland gehen wir nie wieder zurück. Das brauchen wir auch nicht, denn die Welt ist sehr groß“. Die Welt ist groß, ja. Doch darf man deswegen keine Heimat haben? Kully hat dieses Gefühl – sich Zu Hause zu fühlen – nie erlebt. Auf die Frage eines alten Mannes, ob sie nicht Heimweh habe, weiß sie zuerst nicht, was er meint. Nachdem er es ihr erklärt, resümiert sie: Manchmal habe ich Heimweh, aber immer nach einem anderen Land, das mir gerade einfällt.
Weil Irmgard Keun das Leben von Kully und ihrer Familie auf eine so naive und humorvolle Art beschreibt, weiß man beim Lesen nicht, ob man sie für ihr Leben als Weltbürgerin in einer Zeit des nahenden Krieges bemitleiden, bewundern oder beneiden soll. Diese Naivität und der Optimismus sind jedoch nur bei einem Kind authentisch. Es ragt der Schatten der Wissenden, der Erwachsenen, in den Roman. Daran schließt auch die Frage nach der Schuld an dieser Situation an, die man nicht nur auf Kullys familiäre Situation beziehen kann, sondern auf die politische Lage, die sich weltweit zuspitzt. Kully will nicht erwachsen werden, denn das Erwachsensein raubt die Unschuld. Sie überlegt: Aber wozu soll man eigentlich erwachsen werden, wenn man nur traurig davon wird? Meine Mutter hat einmal gesagt, als erwachsener Mensch werde man schuldig; nichts auf der Welt mache aber trauriger, als schuldig zu sein. Der Satz bezieht sich primär auf das private Umfeld der Familie. Die kollektive Schuld der Erwachsenen am Zweiten Weltkrieg schwingt hier in dem im Jahr 1938 erschienenen Roman jedoch schon mit.
Zur Autorin Irmgard Keun
Die Autorin Irmgard Keun (1905-1982) wurde bekannt mit ihren Romanen Gigli (1931)und Das kunstseidene Mädchen (1932). Kurzzeitig genoss sie in den 1930er Jahren ihren Ruhm, bis die Nationalsozialisten ihre Bücher verboten. Sie floh 1936 ins Exil, lebte in unterschiedlichen Ländern und brachte 1938 den Roman Kind aller Länder heraus – eines ihrer eher unbekannteren Bücher.
Weitere Informationen gibt es im Überblick in diesem Video:

https://www1.wdr.de/fernsehen/planet-schule/videos/video-dichter-dran-irmgard-keun-100.html
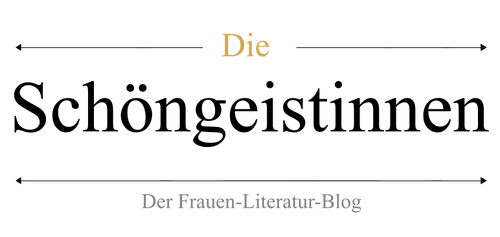

Comments: no replies