Was hat Klavierstimmen mit Käse zu tun? Genauso viel wie Wälder und Schafe mit Konzertflügeln; oder eben überhaupt alles auf der Welt, was irgendwie sinnlich wahrnehmbar ist und über Schwingungen und Intuitionen miteinander interagiert – Wälder ebenso wie große Konzerte, ein ausgereifter Wein wie ein besonders schöner Hammer, oder eben: der Klavierstimmer und das Instrument und die Klavierspielerin und der Raum und die Gegenstände in ihm. Man muss aber nicht unbedingt eine Klavierspielerin oder überhaupt musikalisch begabt sein, um Der Klang der Wälder der japanischen Autorin Natsu Miyashita zu lesen und zu schätzen, die mit diesem unauffälligen, sehr sanften, ereignisarmen und beschreibungsreichen japanischen Roman über einen jungen Klavierstimmer (ein sehr grober alteuropäischer Begriff, das Buch ist eher ein Sprache gewordener japanischer Holzschnitt) erstaunlicherweise in Japan einen großen Verkaufserfolg erzielte und mit dem Japan Booksellers Award dafür ausgezeichnet wurde. 2018 wurde das Buch auch verfilmt von Kojiro Hashimoti; es liegt inzwischen in englischer und deutscher Übersetzung vor (The Forest of Wood and Steel, was wieder einmal eine wenigstens halbwegs kongeniale Titelübersetzung scheint gegenüber dem allzu romantisierenden deutschen Titel Der Klang der Wälder; man lese es besser in Englisch, wenn man es schon nicht in Japanisch lesen kann). Nein, man muss eigentlich nur lesen – und die Perspektive ändern können und wollen.
Natürlich spielt die Autorin (von der man nicht allzu viel weiß, sie hat bisher nicht einmal einen eigenen Wikipedia-Eintrag, weder in der deutschen noch in der englischen Version) Klavier seit ihrer frühen Jugend; und offensichtlich weiß sie, wovon sie spricht, wenn sie das Klavierstimmen auch in all seinen technischen Varianten und Begriffen beschreibt. Und als Hauptfigur hat sie einen Mann gewählt: den Klavierstimmer Tomura, einen jungen Mann ohne Eigenschaften, außer einer: er kann Töne sehen (und hart arbeiten). Aber darauf kommt es auch nicht an, als komplementäre Ergänzung haben wir nämlich die klavierspielenden Zwillingsschwestern Yuni und Kazuna, die mit Tomura ein immer besser aufeinander eingeschwungenes Trio bilden, in dem das Klavier und das Klavierspiel und die Töne mitten im Zentrum stehen. In einem europäischen Roman wäre man hier um die Liebesgeschichte nicht herumgekommen, man ertappt sich selbst bei der Lektüre ständig dabei, dass man diese Wendung erwartet. Sie kommt nicht, ebenso wenig kommen ein Aufbau von dramatischer Spannung, Höhepunkte, erstaunliche Wendungen, ein unerwarteter Schluss. Das verlangt einen entschiedenen Perspektivenwechsel von der europäisch indoktrinierten Leserin; aber dann ist das Leseerlebnis wirklich und wahrhaftig grandios und japanisch und erleuchtend. Erleuchtend, das ist überhaupt ein Bild, das das ganze Buch durchzieht. Es lebt von den verschiedensten Epiphanien, Synästhesien (das sind die europäischen Begriffe dafür): vielfach sinnlich verknüpften Bedeutungserlebnissen also, oder, wie eine im Buch mehrfach zitierte (Wiederholungen, auch das ein deutlich fremdes Element im Roman) Formulierung des idealen Schreibens eines japanischen Dichteres mehr umschreibt und assoziiert als definiert: „Bright, quiet, crystal-clear writing, that evokes fond memories, that seems a touch sentimental, that is unsparing and deep, writing as lovely as a dream, yet exact as reality”. Man sehe einen japanischen Holzschnitt an, vielleicht durchaus einen der bekannteren von Hiroshige; man höre ein Piano im Geiste, es muss kein großes sein und kein Piano-Welthit; man denke an den Duft des Weines, des Käses und des Waldes; und man denke und fühle das alles zusammen, wenn man dieses Buch liest (es ist gar nicht allzu lang und hat sehr schöne Zeichnungen von verwaldeten Pianos). Es ist eine Übung mehr als eine Lektüre, und belohnt wird man: mit unzähligen kleinen Erleuchtungen.

Wie wird man ein guter Klavierstimmer ohne Talent? Ein japanischer Bildungsroman
Ein Klavierstimmer, also: Tomura, jung, eigenschaftslos, ziellos, bis er zum ersten Mal in seinem Leben zufällig einem Klavierstimmer bei der Arbeit zuhört und sieht und sein Erweckungserlebnis hat. Die Ausbildung ist mühe- und aufopferungsvoll, vor allem mit jemand ohne musikalische Vorbildung; keinerlei Förderkurse im ländlichen Japan, dafür aber: Naturerlebnisse, Wälder, Wasser, Stille. Der Zweifel, ob er wirklich, ohne auffälliges „Talent“, ein perfekter, oder nur ein: ein großer, oder wenigstens: ein routinierter Klavierstimmer werden kann, nagen an Tomura wie an jedem jungen (oder überhaupt: jedem) Menschen, der seine Bestimmung sucht, mit ein wenig Offenheit und Redlichkeit sich selbst gegenüber. Denn das macht dieser östliche Bildungsroman, der unendlich weit weg ist von europäischen Selbsthilfebüchern à la „Zum perfekten XXX in zehn Schritten und drei Minuten“ oder “Leben Sie Ihren Traum!“. Nein, „slow and steady“, so sagt es der eine der drei älteren Klavierstimmer, die die Bildung Tomuras nach der technischen Ausbildung fortsetzen, nur so geht es: slow and steady. Über Jahre, eher sechs als zwei, eher zehn als sechs; über so viele verschiedene Pianos wie möglich, die so unterschiedlich sind wie ihre Spielerinnen und Spieler und ihre Räume. Üben, Üben, Üben. Und dann nochmal und am nächsten Tag wieder. Die Werkzeuge polieren wie den eigenen Charakter. Die Menschenkenntnis schulen, denn ein Klavier spielt nie für sich allein, und nur wer die Spielerin erkennt, erkennt das Piano (natürlich ist das eine Wechselwirkung, wie alles auf dieser unendlich verbundenen Welt, keine europäische Einbahnstraßen-Kausalität von Ursache und Wirkung, schön nacheinander). Und so träumt Tomura den alten Traum von einer Idealsprache als Basis einer idealen Verständigung – verlustfrei von begrifflicher Reibung, sozusagen – in der Sprache des Pianos: „how ideal would it be if we could ommunicate solely through the voice of the piano“.
Eine Klavier-Fabel: Ein Piano ist ein Wald ist die Welt
Aber das Piano steht hier nur bild- und behelfsweise für etwas, das der Text auch in vielen anderen Bildern, Erfahrungen, Wäldern findet, und das macht ihn so lesenswert auch für alle Nicht-Musikantinnen. Je länger man liest, desto stärker wird das Gefühl, dass er eigentlich eine Klavier-Fabel ist, oder vielleicht sogar: eine Parabel: über das Leben in vernetzten Systemen, über die Wichtigkeit von Erleuchtung auf dem Weg der Erkenntnis, über Kunst als Kommunikationssystem (ach, diese Begriffe, man entkommt ihnen einfach nicht …), über Menschen- und Weltkenntnis in ihrer ausgereiftesten, kompliziertesten und einfachsten Form. Dafür stehen die wenigen, gelegentlich holzschnittartigen, gelegentlich sympathisch-menschlichen Gestalten neben Tomura, unserem Jüngling vom Lande ohne Eigenschaften. Umkreist wird er von drei Klavierstimmern, die erst zusammengesehen eine Ahnung dessen vermitteln, was der ideale Klavierstimmer (den es natürlich nicht gibt, genauso wenig wie die ideale Sprache oder den idealen Wald) können könnte. Ganz oben steht der weise Itadori, gesucht von den besten Klaviervirtuosen der Welt, der sich aber in einer japanischen Kleinstadt versteckt: Er „entdeckt“ Tomura und begleitet ihn mit wenigen, beinahe allzu einfach klingenden Maximen; es sind aber nur konzentrierte Weisheitssprüche („slow and steady“), die Anwendung muss jede Lernende selbst finden, und als Itadori Tomura seinen eigenen Klavierhammer weitergibt, ist das einer der stillen Höhepunkte des Textes. Dazu kommt der ewig unfreundliche Akino, der jedoch zum sensibelsten Zuhörer wird, sobald er das Haus eines Kunden betritt und in Windeseile die komplexe Interaktion zwischen Klavier und Spieler durchschaut; der den „Ton“ des Spielers immer im Blick behält, gerade nicht den „idealen“ Ton, den er ebenso gut stimmen können; nein, ideal ist der Ton, in dem Spieler und Instrument am besten interagieren und sich selbst wiederfinden, und das kann weit von jeglicher Virtuosen-Perfektion sein (Parabel! Nicht nur eine Klavierstimmer-Regel, sondern eine verpackte Lebensweisheit!) Schließlich Yanagi, der heimlich Übersensible, der seine andere innere Hälfte beim Trommeln auslebt und im Metronom seine Rettung vor dem Chaos und dem Schmutz der Welt gefunden hat. Er belehrt Tomura vor allem über den jungen Mann zunächst höchstlich befremdende Metaphern wie derjenigen vom Käse und seiner Ähnlichkeit mit dem Klavier. Aber nur so wird spürbar, was den „Klang der Wälder“, die Szenerie eines Tones, die Verbundenheit von allem mit allem in der sinnlich wahrnehmbaren Vielfalt der Welt ausmacht: über Analogien, Vergleiche, Metaphern (parabolischer Mehrwert: Nur so lernt man übrigens auch denken jenseits der Begriffskorsette!)
Und schließlich Yuni und Kazune, jüngere und ältere Schwester, die fröhliche lebenszugewandte Yuni und die ernste, ein wenig dunkle Kazune. Zusammen bringen sie ihr gemeinsames Klavier zum Strahlen, aber es der eine große tragische Moment des Textes als Yuni auf einmal nicht mehr spielen kann; es geht einfach nicht mehr, sie setzt sich auf den sorgfältig auf sie abgestimmten Hocker, und der gesamte Fluss, der sonst so natürlich über sie kam und sie selbst erleuchtet schienen ließ, ist blockiert. Der Roman macht kein Drama daraus, wie er auch nichts ein Drama macht, nur eine stille Katastrophe – und Yuni bewältigt sie, mit stiller Größe, indem sie fortan Klavierstimmerin werden will, für Kazune und für ihr gemeinsames Instrument, das ihr Leben ist, ihre Verbindung zur ganzen Welt und zu allen anderen Menschen. Und Kazune wird für beide spielen, ihr Spiel vereint nun die Elemente, die bisher in Yuni und Kazunes Spiel getrennt waren: Ying und Yang. Ein individuelles Opfer, beinahe: undenkbar in einem europäischen zeitgenössischen Roman.
Jenseits der 440 Hertz – Philosophie des Nicht-Absoluten
Aber hier gibt es kein absolutes „richtig“ und „falsch“, ebenso wenig wie es ein absolutes „schön“ gibt; genauso, wie die ideale Stimmung für ein Klavier gar nicht immer vom Standard-Grundton A (440 Hertz) ausgeht, sondern ein wenig darüber oder darunter liegt, je nachdem. Schön sind für Tomura die Milchspuren im Tee seiner Großmutter, eine komplexe Erinnerungs-, Geschmacks-, Geruchs- und Gesichtsepiphanie (die nicht nur entfernt an Prousts Madeleine-Erlebnis in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit erinnert, ein Roman, der übrigens, bei extrem unterschiedlichen Längenverhältnissen, einige Gemeinsamkeit mit dem Klang der Wälder aufweist). Und während des Lesens kann man geradezu spüren, wie man sich befreit von all diesen lästigen Begriffen, von einer immer dominanter werdenden europäischen Ideologie des Absolut-(Moralisch)-Richtigen; wie man näher rückt an die Erfahrungen und ihr Leuchten. Denn die Sprache ist, in ihren konzentriertesten Stellen, „bright, quiet, crystal-clear writing, that evokes fond memories, that seems a touch sentimental, that is unsparing and deep, writing as lovely as a dream, yet exact as reality“. Das ist, bei genauem Lesen (also: Wort für Wort, samt Begriffs- und Assoziationspotential) widersprüchlich? Ja, ganz genau.
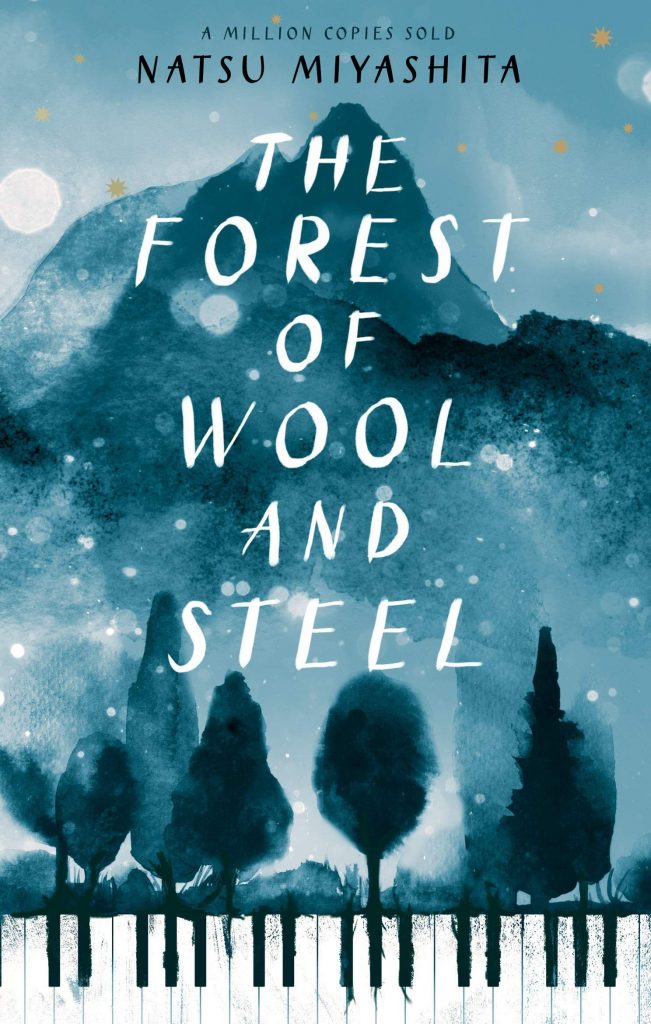
Natsu Miyashita: Hitsuji to Hagane no Mori (2015); übersetzt ins Englische von Philip Gabriel unter dem Titel The Forest of Wood and Steel (2019); übersetzt ins Deutsche von Sabine Mangold unter dem Titel Der Klang der Wälder (2021)


Comments: no replies