Das ist ein Buch, das man jedem in die Hand geben möchte, jeder sowieso. Und dafür ist es auch ausnahmsweise völlig unwichtig, dass es von einer Frau geschrieben wurde, nämlich Maren Wurster. Es ist ihr zweiter Roman, er heißt Papa stirbt, Mama auch; man könnte den Titel auch fortsetzen: Ich, das Kind, auch. Denn es ist nicht nur eine Familiengeschichte; es ist Wursters eigene, und das macht den Mut und die Kraft, die das Schreiben dieses Buches sicherlich gekostet hat, nur noch größer: Denn mit den Eltern stirbt nicht nur die eigene Kindheit, stirbt nicht nur ein Teil der Erinnerung an die Vorfahren, sterben nicht nur die Liebes- und Lebens- und Ehegeschichte einer Frau und eines Mannes. Nein, man selbst stirbt gar nicht wenig mit, und sogar das eigene Kind, die nächste Generation schon, wird an diesem Punkt mit seiner hellen Stimme in seiner kindheits-weisen (nicht alt-klugen!) Sprache fragen: „Sterbst du bald?“ Und was soll man schon sagen auf diese Frage aller Fragen: „Nein“ natürlich, und „ja, ein wenig jeden Tag und in diesen schrecklichen letzten zwei Jahren ziemlich viel“, und dann nimmt man es in den Arm, was sonst?
Die eigenen Eltern kann man aber nicht mehr so einfach in den Arm nehmen. Denn Papa stirbt. Er war ein Mann und ein Ehemann und ein Vater; ob das alles gut oder schlecht, spielt bemerkens- und bewundernswerter Weise keine Rolle in der Erzählung. Er war auch ein Alkoholiker (noch nicht mal das ist schlimm); und er war der letzte Bezugspunkt seiner immer mehr in die Demenz entgleitenden Ehefrau, mit dem er die letzten zwei Jahre im Pflegeheim verbracht hat. Jetzt stirbt er an Krebs, und sie wird den letzten Halt verlieren. Das ist kein schöner Tod, und nach der Lektüre ist man sich noch weniger sicher als vorher, ob es so etwas überhaupt jemals gegeben hat. Es ist ein gruseliger Tod, und Maren Wurster erspart uns kein Detail. Aber dann hat er doch ein winziges Stück Schönheit am Schluss, und das ist genauso wenig lindernde Fiktion und Schöndenkerei wie das ganze Buch, sondern wahrscheinlich einfach nur die kleine Schönheit der Wahrheit: Denn der Vater will sterben, und er sagt es, und die Tochter fragt, wie sie ihm dabei helfen kann, und die Ärzte und die Pfleger geben Dinge zu Bedenken – aber am Ende darf er, in Maßen, frei entscheiden, eine Figur nennt das: „den Körper seinen Weg gehen, den Krebs seine Arbeit machen lassen“. Man könnte auch sagen: die eigene Würde bewahren. Die Autorin zitiert dazu den ebenfalls an Krebs erkrankten Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, der seinem Leben selbst ein Ende setzte und der es, aus der bittersten eigenen Erfahrung heraus, einfach für einen Skandal hielt, dass ein mündiger Erwachsener nicht über seinen eigenen Tod entscheiden könne, sondern als ein psychologisch zu betreuender und medizinisch zu begutachtender Halbverrückter behandelt werde. Jeder, jede sollte das lesen, vor allem aber jene, die politisch über das Sterben anderer Menschen entscheiden.
Und mit Papa stirbt Mama. Sie war eine schöne junge Frau einst, eine verliebte Ehefrau, eine Mutter, die ihrer jugendlichen Tochter durch die Depression half. Und dann war sie immer weniger ihrer selbst mächtig, immer haltloser, immer unvertrauter in einer viel zu groß gewordenen Welt. Die Tochter erzählt auch das gnadenlos genau, gelegentlich auf der Suche nach einem Bild, um das Nicht-Imaginierbare dann doch zu imaginieren. Aber sie wird niemals sentimental, keinerlei Betroffenheitstöne, nur: mitfühlendste Sachlichkeit, empathische Präzision. Keine billige Analyse, keine Anklage, weder gegen das „System“ noch gegen unfähiges oder überfordertes Pflegepersonal; nein, einfach eine Beschreibung von Situationen, in denen alle das Beste wollen, es aber einfach kein Bestes mehr gibt, für nichts und niemand, sondern nur noch anwachsende Verzweiflung neben winzigen Lichtblicken. Und während Papa stirbt und sterben will und das auch sagt, kann Mama – die früher doch einmal Halt und Zentrum der Familie war, die immer noch eine schöne Frau sein kann – noch nicht einmal darüber mehr entscheiden.
Der schreibenden Tochter entgleitet in diesem Prozess die eigene Kindheit, die sie anhand von Fotos und erinnerten kleinen Geschichten festzuhalten versucht, ohne zu wissen, ob das nun noch Wahrheit oder schon Dichtung ist. Da sie zudem eine studierte Frau und Philosophin ist, sucht sie Halt bei den Philosophen und Denkern der Gegenwart; findet in den Orten der Krankheit mit Foucault „Heterotopien“ und die Krankheit als Abweichung, liest mit Walter Benjamin und Susan Sontag Familienfotos als „Archäologie des Verlusts“, versteht Roland Barthes besser und besser, der im Tagebuch der Trauer dem Tod der eigenen Mutter gefolgt war; oder versucht schließlich mit Blade Runner im schwindenden Leben das letzte Menschenähnliche festzuhalten, bevor wir alle durch das Sterben zu Replikanten gemacht werden. Das bleiben unverbundene Versatzstücke im Text, etwas fremdartig; aber man kann auch darüber hinweglesen, wenn es einen stört, und man kann weiter darüber nachdenken, wenn einem danach ist. Vielleicht wird es einige auch stören, dass Wurster den moribunden Zustand der Mutter nach dem Tod des Vaters in einem Wort festzuhalten versucht: „Deprivation“. Ja, das ist ein Fremdwort. Und manchmal drücken eben Fremdwörter, gerade Fremdwörter, das besser aus, was die Muttersprache in diesem Moment verweigert. De-privation, die Be-raubung, das Ent-gleiten, der Ent-zug von etwas, das lebenswichtig ist: Gemeinschaft, Anerkennung als Person, Kommunikation. Während man das Leben verliert, sollte einem nicht auch noch das alles entzogen werden.
Wir alle sind durch Corona depriviert worden. Die Folgen sind noch unklar. Daneben wächst ein Kind auf, das der Autorin nämlich (Maren Wurster ist auch Mitglied im Autorinnen-Kollektiv Writing with CARE/RAGE, eine Vereinigung schreibender Mütter). Am Ende des Buches sieht man – nicht, wie die Eltern sterben; den letzten Moment erspart Wurster uns, und das ist gut so. Nein, man sieht, wie das Kind der Mutter nun bis zum Bauch reicht, so groß ist es schon geworden! Seine Großeltern sind gestorben oder werden jeden Moment sterben, seine Mutter hat mit ihrer Kindheit ihre Kindschaft verloren; sie muss jetzt, mit Roland Barthes gesprochen, „ihre eigene Mutter“ sein. Das Kind ist ein stiller Beobachter gewesen in dieser Zeit, und als Mutter möchte man sich nicht ausdenken, was es dabei gedacht und empfunden haben mag („sterbst du bald?“). Deshalb, umso mehr und erneut: Jede, jeder sollte das lesen, sollte es genau lesen, die unappetitlichen und verstörenden Details lesen, aus der Intensivstation, aus der Pflegestation, von der Zerstörung des Körpers und der Seele, von der durch Corona noch potenzierten grauenhaften Einsamkeit des Sterbens. Man kann niemanden ersparen, dass die eigenen Eltern sterben. Jede und jeder von uns wird durch Alter, Demenz, Krankheiten und den langen Sterbeprozess auf die Probe gestellt werden. Es ist unser aller Geschichte und eine ganz persönliche. Sie ist geschrieben mit (das ist alles zusammen möglich!) der vibrierenden Liebe einer Tochter und dem genauen Blick einer Autorin, in einer ebenso präzisen wie alltäglichen Sprache und ohne (das kann man nicht genug betonen!) jeglichen moralischen Zeigefinger, ohne Anklage, ohne Schuldzuweisung an andere Leute, Instanzen, Systeme. „Papa stirbt, Mama auch“. Das sagt es schon alles.
Leseprobe:
„Du hast dieses kleine Loch da. Zwischen dem gewölbten Bauch und der Brust. Da, wo diese Falte ist, der Bauch abfällt und der Brustkorb beginnt. Hast ja nichts an, nur dieses gepunktete Stück Stoff, das im Nacken gebunden wird und am Rücken frei bleibt. Es liegt zerknüllt auf deiner rechten Körperhälfte, das Band schneidet in deinen Hals, verschwindet in einer Falte.
„Ein Leberfleck“. Die Krankenschwester deutet auf das Loch. Sie auf der einen Seite deines Bettes, ich auf der anderen. Du hättest dir wahrscheinlich einen Leberfleck abgerissen. Über dich hinweg sagt si das. „Hat sich wahrscheinlich einen Leberfleck abgerissen“.
Und jetzt hast du da ein Loch, so groß wie mein kleiner Fingernagel. Und darunter irgendwelche Schichten. Fett, Muskeln, Sehnen. Durch deine Atmung, dadurch, dass sich der Bauch bewegt, dehnst sich das Loch auseinander. Ich mag nicht so genau hinsehen. Die Schwester sprüht Desinfektionsmittel auf die Stelle und klebt ein Pflaster darüber. Vorsichtig decke ich dich mit dem Kittel zu. Dein Kopf bewegt sich in meine Richtung, und ich sehe, dass dein Hals durch die Reibung des Bandes wund ist.“ (S. 7)


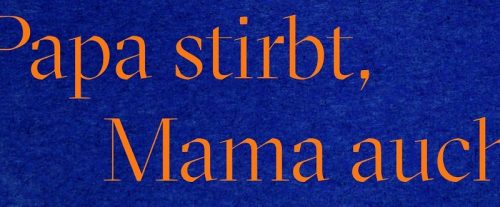
Comments: no replies