Empfindsame und romantische Reisen von Frauen
Heute machen wir zuerst eine (längere) empfindsame Reise, dann eine (kürzere) romantische! Und wir fragen in diesem Zusammenhang, auch wenn es natürlich eine Frage ist, die weder objektiv noch vollständig noch gar korrekt beantwortet werden kann: Reisen Frauen anders? Und nein, es geht dabei nicht darum, dass Frauen irgendwie sentimentaler, gefühliger oder weltfremder beim Reisen sind als Männer; man könnte sogar sagen: Das Gegenteil ist der Fall! Warum dem so sein könnte – mögen die Beispiele demonstrieren!
1 Empfindsam reisen als Schule der Empathie: Sophie von La Roche
Der Begriff „empfindsam“ wurde geprägt von dem irischen Schriftsteller Laurence Sterne mit seiner Sentimental Journey, er gab der Zeitströmung der Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert den Namen, und er meint: Man reist jetzt ebenso, nein vielleicht: noch mehr mit dem Herzen als mit den Augen. Man sieht und besucht also nicht nur die touristischen Höhepunkte Europas, sondern man konzentriert sich auf die Menschen, ihre Schicksale, Leiden und Freuden; man leidet mit und freut sich mit, und man wird dabei – so die Theorie – letztendlich zu einem besseren Menschen, denn, mit Lessing gesagt: Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch! Wie ändert das nun die Reisepraxis; und inwiefern reisen Frauen empfindsam?
Sophie von La Roche, geboren 1730 in Kaufbeuren in Oberschwaben in einem gutbürgerlichen Haushalt, Kurzzeit-Verlobte von Christoph Martin Wieland, erfolgreiche Romanautorin, Herausgeberin der ersten deutschen Frauenzeitschrift und nicht zuletzt: Mutter von acht Kindern, von denen fünf das Kindesalter überlebten; Sophie von La Roche war auch eine fleißige Reisende und Reiseschriftstellerin. Reiseberichte waren eines der großen Erfolgsgenres der Aufklärung, dienten sie doch der Unterhaltung und Belehrung gleichermaßen (und man muss immer dazu denken: Es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet, und was man von fernen Ländern wusste, entstammte Reiseberichten!). Man konnte tatsächlich Geld mit ihnen verdienen; und Sophie von La Roche finanzierte tatsächlich unter anderem damit den Lebensunterhalt ihrer Familie. Von 1787 bis 1793 veröffentlichte sie mehrere Reiseberichte, im Titel angekündigt als „Tagebücher“ oder „Journale“, von ihren Reisen in die Schweiz, nach Frankreich sowie durch Holland und England. Letzteres, das Tagebuch meiner Reise nach Holland und England, leitet sie dementsprechend mit dem Ausruf ein (und einem direkten Bezug auf Sterne, nämlich dessen Erzählfigur „Yorick“):
Wieder eine Reise! Werden meine Freunde, meine Kinder und Bekannte sagen. Ja es werden Alle staunen, daß eine Frau, in meinen Jahren, die Gelegenheit und den Willen hat, solche Reisen zu machen, welche sonst ganz allein die Sache der Jugend, des Reichsthums, der Freiheit und der Geschäfte, sind. Yorik setzte noch zwei Arten Reisende hinzu: Kranke, die eine Hülfsquelle aussuchen, und Wißbegierige, welche sich, auch ausser ihrem Wohnort, nach der Erde und ihren Kindern umsehen. Zu der letzten Gattung gehöre ich; und meine Geschäfte sind – an der Seite einer höchst edlen Freundin, welche wegen ihrer Gesundheit reiset – mich umzusehen, und alles zu bemerken, was mir Unterricht und Freude geben kann. Da mein Herz mir das Zeugniß giebt, und alle, die mich kennen, wissen, daß ich so gerne alle Menschen glucklich sehen mögte, and immer gerne zu der allgemeinen Zufriedenheit beitrug; so hoffe ich, daß man diese, wirklich edle große Freude, auch mir gerne gönnt, und daß meine Kinder die Erzählung davon gerne lesen werden; besonders, da ich bei dieser letzten Reise, wie bei der ersten, einen meiner Sohne bei mir habe.
Der empfindsame Tonfall, in dem der Reisebericht durchgängig gehalten ist, wird hier schon deutlich. Aber der Text ist gar nicht sentimental in einem negativen Sinn: nicht gefühls- oder tränenselig, wenig geprägt von der überenthusiastischen Sprache vieler empfindsamer Texte. Natürlich gibt es gelegentlich empfindsame Landschaftsbeschreibung; eine solche Passage demonstriert direkt die therapeutische Wirkung einer solchen gefühlvollen Sicht auf die Natur als Landschaft:
Aber die Betrachtung einer schönen Gegend erweitert und erweicht ein gefühlvolles Herz. Freude und traurige Ideen bekommen eine sanfte Gestalt und Farbe. Unmöglich ist mir dabei, daß ich nicht an die alte und neue Bewohner denken sollte.
Die empfindsame Wirkung schlägt aber hier diekt in ein soziales Interesse: Landschaft kann nicht unabhängig von ihren Bewohnern gedacht werden; und immer wieder beschreibt la Roche deshalb auch die agrarische Nutzung der Landstriche. Mit den Bewohnern kommt sie, wo immer es geht, in ein offen geführtes Gespräch; sie lässt sich die Familienverhältnisse schildern, die Einkommenssituation, die konkreten Lebensumstände, die Probleme, Sorgen und Kümmernisse. Zudem ist die gesamte Reise, vor allem im späteren Teil in London, geprägt durch Besuche bei Bekannten, Freunden und lokalen Berühmtheiten. Auch hier nutzt la Roche die Gelegenheit, sich alles ausführlich zeigen und erzählen zu lassen, was zum Verständnis einer Stadt oder des gesamten Landes, seiner Geschichte und seiner Gegenwart beiträgt; sie gibt dazu manchmal ganze Gespräche praktisch wörtlich wieder.
Auch Anekdoten sind dabei. So referiert sie ein Gespräch mit einem „Philosophen“ in Holland, der ihr darlegt, dass die holländischen Staaten die einheimische Zuckerproduktion massiv subventionieren, um „andere (also: ausländische) Zuckersiederein zu Grunde zu richten“ (man sieht, dass vieles unerwartet aktuell ist); und ihre große Aufmerksamkeit beim Zuhören erklärt er sich durch ein klassisches Geschlechterstereotyp:
„Da vermuthete der stolze Scharfsinn des Mannes, daß meine ernste Aufmerksamkeit durch die Idee des Zuckers entstanden sey. – Aber er irrte sich, wie Männer des höchsten Geistes sich oft in ihren Urtheilen über uns irren. – Denn mein Ernst ruhte auf dem Gedanken: Wie menschenfeindlich die Gewinnsucht in diesem Versprechen handelt, indem sie Preise zum Untergang dieses Nahrungszweiges bei andern Nationen aussetzt
Wiederum zeigt sich hier die Verbindung von empfindsamer Grundhaltung und umfassendem Wissensdurst. Dazu kommt jedoch, und nicht nur hier: ein weiblicher Scharfsinn, der eben nicht so „stolz“ ist wie derjenige des vermeinten Philosophen, sondern geprägt durch Offenheit, ein waches Auge und ein bewegliches Gehirn. Denn Sophie von la Roche ist, das zeigt sich schon bei der Reise durch Holland, wirklich interessiert an allem: an dem Alltag der Holländer ebenso wie an ihrer Wohnkultur, ihren Essgewohnheiten, ihrer Kunst, ihren sozialen Institutionen und ihrer Geschichte. Einiges davon mutet „weiblich“ an; so als sie mit Begeisterung erläutert, wie die Holländerin eine Form von Lockenwicklern verwenden. Oder ihre ebenso enthusiastische Beschreibung der holländischen „Garküchen“, also einfacher Speisegaststätten,
„in welchen die Speisen so niedlich geordnet dastehen, die Schüsseln und Teller so silberartig geputzt sind, und die Hauswirthin mit ihren goldenen Ohrringen, weissen Schürze, Haube und Halstuch, den vollen und runden Backen und dem ruhigen Blick wirklich Lust giebt, ein Stück kalte Pastete, Braten oder Schinken zu essen“
Ist das nun weiblicher Blick, oder ist es ganz einfach: die Betrachtung von Essen und Kleidung als Bestandteil einer Nationalkultur, deren „allgemeiner Geist der Ordnung“ der Reisenden ebenso imponiert wie die sagenhafte Reinlichkeit, Fleissigkeit und Effizienz der Holländer im Allgemeinen? Sind das Nationalstereotype oder ist das eine Art ethnologischer Mentalitätsanalyse? Wie auch immer man das entscheiden oder beurteilen mag – weiblich ist an Sophie von La Roches Beobachtungen vor allem ihre immense Aufmerksamkeit auf den Alltag und auf die vielfachen Verflechtungen von individuellem Leben, öffentlichen Institutionen, politischer Geschichte und ökonomischer Situation; das alles gekoppelt mit einer lebendigen Beschreibung und einer menschlich mitfühlenden Haltung. So besucht sie beispielsweise eine Ziehung der Haager Lotterie, einer staatlichen Glücksspielinstitution, und sie reagiert gleichermaßen empfindsam wie empathisch darauf:
„der Gedanke, daß gewiß das Vermögen von vielen Familien in diesen sogenannten Glücksrädern umgetrieben und verloren wurden – gab mir die halbe Stunde über viel düstere Gedanken“
Sie besucht, das gehört zum klassischen touristischen Programm von jeher, Gemäldegalerien (wiederum: die berühmtesten Werke der Kunstgeschichte waren oft nur in unvollkommenen Abbildungen in teuren Druckwerken zugänglich); sie ist begeistert von der holländischen Genre- und Landlebenmalerei, aber ebenso von einem weiblichen Genre:
„Eine Stickerei der Frau Statthalterin verdient hier zu seyn, indem sie, mit gleichem Geist und Fleiß, mit der Seide und Nadel ausführte, was zu beiden Seiten der Pinsel in Oehlfarbe that“.
Besonders begeistert ist sie von der Stadt Amsterdam, ihrer großen Vergangenheit ebenso wie ihrer gegenwärtigen Betriebsamkeit, ihren weitreichenden Handelsverbindungen, aber auch der kulturellen Dichte an Galerien, Bibliotheken und Sammlungen (das wird sich in London wiederholen): Wirksame, effiziente, praktische Tätigkeit, das ist ein wichtiges gesamtaufklärerisches Ideal, das gelegentlich gegenüber den „hohen“ aufklärerischen Zielen in den Hintergrund tritt. Sophie von La Roche sieht ganz klar, dass der ökonomische Erfolg der Holländer erst die Grundlage ihres Wohlstandes und dann ihrer politischen Verfassung bildet; ohne Wohlstand, ohne ein erfolgreiches ebenso wie gebildetes Bürgertum ist Aufklärung (zumindest nach dem europäischen Modell) unmöglich. Aber sie sieht auch, eben: weil sie eine Reisende ist und weil sie gerade vorher in der Schweiz war (in England wird Frankreich den Vergleichsmaßstab bilden), dass es verschiedene Varianten menschlicher Entwicklung und Glückseligkeit geben kann:
„In der Schweiz sah ich Ströhme, die unaufhaltsam nach den Gesetzen der Natur herunter fließen: – hier das Meer, durch Menschenhände in Gränzen eingeschlossen. – Zwischen ewigen Felsen der Schweiz Menschen, deren Sinne und unsterblicher Geist nichts begehren, als was ihr enges Thal und ihre Heerden ihnen geben; hier, zwischen beweglichen Sandhügeln, ewige tausendfache Bemühung nach Uebermaaß des Ueberflusses aller Güter der Erde. Die frohe Genügsamkeit der Alpenbewohner, und die ernste, immer rege Betriebsamkeit der Holländer, sind aber beide gleich scheinbare Gaben der Vorsicht, nach den angewiesenen Wohnplätzen ihrer Kinder ausgetheilt.“
Lebensart, Mentalität, ökonomische wie politische Verfasstheit – dies alles wird geprägt durch die natürliche Umgebung, durch geographische Randbedingungen, und ein Meeresvolk wird sich anders entwickeln als ein Binnenland, eingeschlossen von Bergen. Das ist, für die überzeugte Christin Sophie von La Roche wie für ihre Zeitgenossen, ein Werk der Vorsehung, die für den Menschen wie eine gute Mutter sorgt, indem sie ihnen angemessene „Wohnplätze“ anweist. Einer ist dabei nicht besser als der andere; aber es ist auch ganz natürlich, dass eine Mutter für einige ihrer Kinder eine stärkere Neigung hat als für andere. Und Sophie von La Roche zieht es, so wie es Goethe nach Italien zog, nun mit aller Gewalt: nach England! England das neue Sehnsuchtsland der Aufklärung; nicht nur, aber vor allem: die Empfindsamkeit ist von Grund auf anglophil, und auch in La Roches Romanen spielt England immer wieder eine Rolle. Kurz vor der Überfahrt nach Dover (es wird schauklig und stürmisch, und sie wird seekrank, wie alle Reisenden auf dem Meer) schreibt sie, ihre Reiseliebe und ihre Englandliebe verbindend:
„Bücher und Reisen waren immer für mich die einzige vollkommne Glückseligkeit dieses Lebens. Besonders England, dessen Geschichte, Schriftsteller und Landwirthschaft ich mir schon so lange bekannt machte , sie schon so lange liebte – war immer ein Punkt nach welchem meine ganze Seele begierig war“
Die einzig vollkommne Glückseligkeit dieses – also: des irdischen – Lebens: Das sind starke Worte! Und dasjenige Reiseland, in dem all diese Vollkommenheit für Sophie von La Roche am stärksten zum Ausdruck kommt, ist England, das sie nun, im Jahr 1786? erstmals betritt, noch schwankend von der Überfahrt. Von Anfang an ist sie hellauf begeistert; schon auf der Reise nach London bewundert sie die Landschaft, die Kleinstädte, die Vorgärten, überhaupt: den „Verstand in allem“! In London, wo sie sich länger aufhält, absolviert sie dann ein strammes touristisches Besuchsprogramm. Dazu gehören nicht nur die klassischen Sehenswürdigkeiten, Westminster, der Tower, St Paul; natürlich die großen Museeen und Galerien, die großen Sammlungen und und und (die alle ausführlich beschrieben werden; besonders interessant ist eine Passage über die Tierhaltung in einem Teil des Towers, wo Löwen, Leoparden, Tiger, Wölfe, eine Hyäne, ein junger Adler, Bären und Affen gehalten werden). Nein, sie besichtigt auch eine Fabrik mathematischer und physikalischer Instrumente, wohnt einer Teeversteigerung der ostindischen Gesellschaft bei oder streift durch eine Bank. Sie inspiziert das berüchtigte Irrenhaus Bedlam, beschreibt Wohnverhältnisse und Zwangsjacken und erkundigt sich dort besonders nach dem Schicksal und der Geschichte weiblicher Insassen. Anschließend besucht sie eine Buchhandlung, die sie als „Apotheke […] in welcher alle Hülfs- und Verwahrungsmittel gegen die Seelenkrankheit zu finden sind“ (wir erinnern uns: Bücher sind neben dem Reisen die zweite volllkommene Glückseligkeit dieses Lebens“). Sie geht häufig in die verschiedenen Londoner Theater und beschreibt Aufführungen ebenso wie Architektur, Inszenierung, Schauspieler, die Besucher (besonders interessant hier: eine Anekdote, wie sie in einem starken Londoner Regen nach dem Theaterbesuch keine Kutsche bekommt und sich kurzzeitig auf dem Vorplatz aufhalten muss, wo eine „Menge lustiger Mädchen“ wohl auf Kundschaft warten; das Schicksal englischer Prostituierter wird auch an anderer Stelle direkt angesprochen). Sie liest täglich die lokalen Zeitungen, ist beeindruckt von Breite wie Tiefe der Berichterstattung und notiert einmal, durchnumeriert, den Inhalt einer ganzen Ausgabe bis hin zu den Anzeigen.
Und sie spricht weiterhin, wo immer es geht, mit den Menschen; nicht nur ihren Bekannten und den Berühmtheiten, sondern auch einmal mit einem Schwarzen, der „als Mohr der Gräfin“ ihr den Kaffee bringt; es ist, wie sich herausstellt, ein ehemaliger Sklave, der von wohlmeinenden Engländern nach Europa gebracht wurde, um dort „schreiben, rechnen, Chirurgie und andere Kenntnisse zu lernen“. Durchgängig äußert sie sich dabei, wie wir heute sagen würden; massiv kolonialismuskritisch; so auch an dieser Stelle:
„Ihr wißt Kinder, daß das Schicksal der Neger, immer meine Seele bewegte, und immer sah ich sie mit Trauer an; ich sprach mit diesem Menschen, weil ich Züge eines sanften Charakters an ihm bemerkte“.
„Züge eines sanften Charakters“ – das ist unter anderem deshalb bemerkenswert, weil es gegen ein zeitgenössisches Klischee des rohen, ungebildeten, zivilisierter Gefühle nicht fähigen Farbigen verstößt. La Roches Kolonialismuskritik zehrt aus ihrer Empfindsamkeit; aber ist das nicht andererseits genau dasjenige Verhalten, das wir heute als Empathie bezeichnen würden und als eine Quelle menschenfreundlichen Verhaltens wertschätzen?
Es sind ausgefüllte Tage in London und Umgebung, jede Minute scheint genutzt; dazu muss die enorme Schreibarbeit kommen, denn la Roche führt regelmäßig ihr Reisetagebuch, das dann in Form von Briefen an ihre Kinder die Grundlage der Veröffentlichung bildet. Und wenn sie könnte, die Kraft und die Zeit hätte, würde sie noch viel mehr tun:
„Ich würde jede Manufaktur besuchen; Große und Kleine bei ihren Festen und bei ihrer Trauer beobachten; auch die Sprache mir so eigen machen, daß ich alle Reden im Parlament verstehen könnte. Landwirtschaft des armen und reichen Bauern -, das Leben des Edelmannes, des Pfarrers und des Richters – Alles wäre Gegenstand meiner Aufmerksamkeit; so wie die Arbeit der Bäuerin, der Handwerksfrau, und besonders auch der Kindsmägde, neben dem allgemeinen Ton der Erziehung“
Dies alles zusammengenommen erklärt, warum Reisen die „einzige Vollkommenheit“ in diesem Leben ist. Denn Reisen verschafft konzentrierte Welt- und Menschenkenntnis, nicht aus Büchern, sondern aus der eigenen Anschauung; jeder Tag bringt derjenigen, für die schlechthin „Alles“ der Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit ist, neue Nahrung, neue Gegenstände, neue Menschen – Erfahrungen, die Geist und Herz gleichmäßig in Tätigkeit und Bewegung halten. Und es ist eine Quelle neuer Erfahrung, die niemals versiegt; jedenfalls für die, die offene Augen und Ohren hat und die nicht nur in sich selbst hinein, sondern energisch und konzentriert nach außen, auf die Welt und die Menschen in ihr schaut (das gegen ein verbreitetes Vorurteil über die Empfindsamkeit als selbstverliebt und egozentrisch). Insofern ist la Roches Reise, im Unterschied beispielsweise zu Goethes Italienreise, keine Selbstfindungsreise. Sie wird nicht neu geboren in England, das braucht sie nämlich gar nicht; sie hat acht Kinder geboren, das reicht. Vielleicht kann man sogar im Gegenteil und etwas provokant sagen: Nicht die empfindsame Grundhaltung ist typisch für die „weibliche“ Art des Reisens, wie sie Sophie von La Roche praktiziert; sondern ihre Neugier auf und Offenheit für alle Arten von Erfahrung auf allen Ebenen und in allen Bereichen des Lebens, „Groß und Klein“, Mann und Frau, Feste und Trauer. Sie ist eine gereifte Frau, sie geht auf ihrer fünfzigstes Lebensjahr zu; aber sie hat keine midlife crisis, sondern sie genießt die relative Freiheit, die ihr ihre Reisen bieten und nützt sie aus, sehr aufklärerisch: im Sinne der Vermittlung nützlichen Wissens über andere Länder und anderer Völker, moralisch nützlich und, wo es geht, unterhaltsam. Dass man damit auch Geld verdienen kann, ist umso besser! Am wichtigsten aber ist: Reisen bewegt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist; und für viele Menschen, egal ob Mann oder Frau, ist das wohl einfach der größte vorstellbare Jungbrunnen und vielleicht sogar: sein natürlicher Zustand?
2 Romantisch reisen als Bienenflug der Phantasie: Mary Shelley
Schon ihre Mutter hatte einen Reisebericht veröffentlicht, auch er war ein großer Erfolg. Die 1796 erschienenen Letters Written in Sweden Norway, and Denmark von Mary Wollstonecraft waren das Ergebnis einer abenteuerlichen Reise mit einem ungewöhnlichen Ziel; und sie unternahm die Reise tatsächlich nur gemeinsam mit ihrer gerade zweijährigen Tochter und ihrer Dienerin. Ganz so abenteuerlich ist die Reise, die ihre Tochter, die beinahe gleichnamige Mary Wollstonecraft Shelley, beschreibt, dann doch nicht: Die mit dem Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus (1818) in die Literaturgeschichte eingegangene Romantikerin bereist mit ihrem 18jährigen Sohn und einigen seiner Studienfreunde Italien, das alte und neue Sehnsuchtsland deutscher Reisender. Für sie war Italien zunächst mit schmerzhaften persönlichen Erinnerungen verbunden: In Italien war ihr Ehemann Percy Bysshe Shelley bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen; ihr dreijähriger Sohn war dort an Malaria gestorben, und sie hatte eine Missgeburt, die sie beinahe das Leben kostete. Doch auch sie tritt diese neue Reise an bekannte Orte mit größerem Abstand als gereifte Frau im fünften Lebensjahrzehnt an; und als erfolgreiche Schriftstellerin, genau wie Sophie von La Roche. Ihre Rambles in Germany and Italy (deutsch als Streifzüge durch Deutschland und Italien) beschreiben, ebenfalls in einer fiktionalisierten Briefform, die längere Anreise durch Deutschland bis zur Ankunft in Mailand; der zweite Band deckt dann die Rückreise ab, von Antwerpen nach Prag.
An dieser in gewisser Weise „romantischen“ (im Sinne der Zeitströmung), in gewisser Weise aber auch immer noch aufklärerisch-empfindsamen Reise sollen vor allem zwei Aspekte hervorgehoben werden. Zum einen lenkt Shelley ganz pragmatisch die Aufmerksamkeit an mehreren Stellen auf die unterschiedlichen Verkehrsmittel. Denn gerade war in England dasjenige Verkehrsmittel eingeführt worden, dass das Reisen völlig revolutionieren sollte und wesentlich dazu beitrug, dass England das Pionierland des europäischen Tourismus wurde: die Eisenbahn nämlich. Keine kraftraubenden tagelangen Reisen mit voll bepackten Kutschen, nervigen Mitreisenden, gebunden an den Rhythmus der Poststationen und des Pferdewechsels! Und so schreibt auch Shelley, als sie in Frankreich unterwegs ist:
„In England haben wir nächtliche Reisen schon fast vergessen – dank der Eisenbahn, der ich trotz aller Fehler ewig dankbar bin, denn sie hat es mir ermöglicht, viele neue Orte zu besuchen“
Die Eisenbahn erweitert speziell den Radius möglicher Reisen für Frauen. Und auch ein zweites Verkehrsmittel hat es Mary Shelley angetan, genauso wie vor ihr Lady Montague – und auch Sophie von La Roche lobt die Schiffsreisen auf Flüssen mit ihren sanften Bewegungen und freundlichen Schiffskapitänen. Hier kann man aber auch deutlich sehen, wie das aufklärerische Reisen durch ein romantisches Reisen mit anderen Zielen und Zwecken abgelöst wird; in Beschreibung einer Schiffsreise schreibt Mary Shelley nämlich:
„es macht alles Freude, besonders auf einer Reise, die man noch nie zuvor gemacht hat und die daher gemischt ist mit einem Tropfen Unsicherheit und dem starken Reiz des Neuen, der nicht mit Worten zu beschreiben ist – Du musst deinen Teil der Aufgabe erfüllen, nachempfinden und fantasieren, sonst sind alle Schilderungen öde und nutzlos“
Die Leserin muss bei der Lektüre also genauso ihre Phantasie aktivieren, wie die Autorin bei der Betrachtung der vorbeigleitenden Landschaften; Landschaftsbeschreibung um ihrer selbst willen oder zur Erläuterung agrarischer Lebensformen wird nicht mehr angestrebt. Sophie von La Roche würde gemäß einer Unterscheidung, die Shelley an einer Stelle ergänzend zu Sternes Klassen von Reisenden einführt, wohl demgegenüber zu den „neugierigen Reisenden“ mit einem „echten Wissensdurst“ gehören; jedoch nicht zu den „allwissenden Reisenden“, die jeden Mitreisenden mit ihrem allumfassenden Pseudo-Wissen über alles und jedes belehren.
Zum zweiten: Für Mary Shelley ist das Reisen ein anderer Lebens-Zustand, ein expliziter Gegenpol zur gesellschaftlichen Existenz. Sie sinniert:
„Die Gesellschaft misst den Menschen an seinen äußerlichen Besitztümern – das Einkommen, die Verbindungen, die Positionen haben mehr Gewicht als alles andere – und man selbst ist nur eine Feder auf der Wagschale. Aber was kümmert es mich jetzt? Mein Zuhause ist das günstigste Fortbewegungsmittel, das ich auftreiben kann, oder der Gasthof, in dem ich übernachte – meine einzigen Bekannten sind meine Reisebegleiter – und meine einzige Lebensaufgabe besteht darin, die vorüberziehende Landschaft zu bewundern“
Das klingt, ebenso wie der „Tropfen Unsicherheit“ im vorigen Zitat, schon etwas abenteuerlustiger und atmet vielleicht auch ein wenig den Geist ihrer Mutter, die mit einem Kleinkind Europas rauen Norden bereiste. Mary Shelley hat für diese Reise offensichtlich begrenzte finanzielle Mittel, es geht teilweise wirklich um das „günstigste“ Fortbewegungsmittel – oder auch die günstigste Übernachtungsmöglichkeit; an einer Stelle heißt es: „den höchsten Preis bezahlten wir natürlich in dem schlechtesten Gasthaus in Brückenau“. Aber passagenweise ist es auch ein durchaus klassischer Reisebericht; Land und Leute, Kunst und Kultur, Landschaft und Geschichte – aber nicht mehr empfindsam gesehen, sondern aus einer dezidiert individuellen Perspektive und mit wechselnder Stimmung und Beleuchtung.
In der Gesamtbewertung jedoch trifft sich Mary Shelley auf bemerkenswerte Weise mit ihrer Vorgängerin Sophie von La Roche, nämlich in einem ganz umfassenden Reiselob:
„Und außerdem – was könnte herrlicher sein, als immer wieder Neues zu erleben, als der unerschöpfliche Strom neuer Ideen, die einem auf Reisen kommen? Wir lesen, um uns Gedanken und Wissen anzueignen; Reisen ist ein Buch, das der Schöpfer selbst geschrieben hat, und es enthält höhere Weisheit als das gedruckte Wort des Menschen …. Das Zuhause mit Erinnerungen zu schmücken, wie eine Biene den Stock verlassen und auszuschwärmen, um mit dem Honig der Reisen zurückzukehren – mit Szenen, die das Auge nie vergisst – mit wilden Abenteuern, die die Fantasie beflügeln – mit Wissen, das den Geist erleuchtet und ihn von hartnäckigen, tödlichen Vorurteilen befreit – mit größerem Verständnis für unsere Mitmenschen –, das sind die Segnungen des Reisens. Ich bin überzeugt, das sie jeden besser und glücklich machen“
Auch hier: stärkere Betonung der Phantasie, der gelegentlichen Abenteuerlichkeiten im Sinne der Romantik – aber eben auch: Reisen als die einzige Situation im Leben, in der es ständig und unerschöpflich Neues gibt; als Prozess, in dem nicht nur Erlebnisse, sondern auch Wissen und menschliches Mitgefühl angesammelt, gehortet werden können. Das ist für Frauen im 18. und auch im 19. Jahrhundert so wichtig, um das noch einmal zu betonen, weil selbst für Autorinnen wie La Roche und Shelley der persönliche Wirkungsradius doch im Großen und Ganzen auf die Familie beschränkt war; sie konnten nicht hinaus ins Leben, wie die Männer, und umso befreiender, ja geradezu beflügelnder mussten sie das Reisen erleben!
***
Zum Abschluss noch eine Fußnote zu den Frauen und Fortbewegungsmitteln und der damit verbundenen Erweiterung des Reiseradius: Was Mitte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn war, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Automobil – eine Chance und eine Befreiung, auch und vor allem für Frauen. So war auch Virginia Woolf (die leider niemals einen Reisebericht schrieb) ganz begeistert, als sie und ihr Ehemann sich 1927 das erste gebrauchte Auto kauften. Sie notiert in ihren Tagebüchern, sie hoffe dadurch, „dieses merkwürdige Ding, die Weltkarte im eigenen Kopf“ zu erweitern; das Auto schenke ihnen ein zweites Leben, in dem man sich „frei & beweglich & luftig“ bewegen könne, „so leicht & beweglich wie ein Habicht in der Luft“, im Gegensatz zur „gewöhnlichen stationären Tätigkeit“. Leider meisterte Virginia Woolf das Autofahren – das technisch wohl etwas schwieriger war als heutzutage – nicht, so dass ihr Ehemann kutschieren musste; aber gleichwohl verdanken wir dieser besonderen Erfahrung, die man in einem Auto machen kann, während die Welt vorbeizieht, auch kleine Meisterwerke wie den Essay Evening over Sussex: Reflections in a Motor Car.
3 Reisen Frauen anders?
Reisen Frauen nun anders? Nun, die sichere Antwort, die auch alle Fallen von Geschlechterstereotypen vermeidet, ist: Jeder und jede reist anders. Aber wenn man nun trotzdem, auch aufgrund eigener Erfahrungen, eine etwas verallgemeinerte, notwendig ein wenig stereotypisierende Aussage wagen wollte: drei Dinge!
Wenn Frauen reisen, ist Shoppen erlaubt! Das hört sich sehr trivial an, aber man kann es auch hochtrabend rechtfertigen, indem man auf den anthropologischen und ethnologischen Aspekt einer Einkaufskultur verweist (siehe oben).
Es ist darüber hinaus denkbar, dass Frauen eine größere Aufmerksamkeit auf alltägliche Dinge richten – auf Kleidungsfragen, Art und Zubereitung des Essens, Wohnverhältnisse beispielsweise. Damit einher geht ein vielleicht etwas größeres Interesse für soziale Fragen, für Lebensverhältnisse insgesamt; vielleicht könnte man in der Tradition la Roches von einem mehr empathischen Reisen sprechen?
Und schließlich, um noch einmal zu den kleinen Dingen des Alltags zurückzukehren: Sind bis heute viele Frauen unendlich dankbar für das gemachte Essen, das gemachte Bett und all die vielen Dienstleistungen, die sie selbst sonst an jedem Tag des Jahres weitgehend fraglos verrichten! Das alles ist nicht weltumstürzend und lebensreformierend; aber es sind Akte der Befreiung für anderes, es ist auch eine Befreiung des Geistes für neue Anregungen und Erlebnisse!
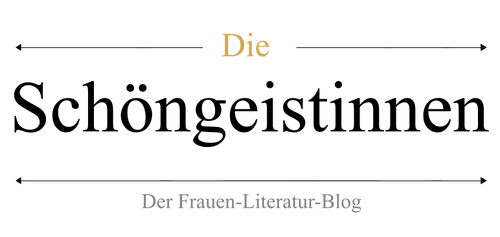

Comments: no replies