Arundhati Roys neues Buch über ihre Mutter, ihr Schreiben und über Indien
Vielleicht kann man dieses Buch nicht verstehen, wenn man niemals in Indien gewesen ist. Wenn man nicht die Großartigkeit dieses großen Landes und seiner Menschen erlebt hat, seine unglaubliche Armut und seinen blendenden Reichtum. Indien ist alles, was die Menschheit kann und hat, im Extrem.
Deshalb muss man sich stark genug fühlen, wenn man sich als blasse Europäerin an diesen Gewaltakt eines Buches wagt: Mother Mary Comes to Me (deutsch unter dem nicht ganz so blasphemischen, sondern eher blassen Titel: Meine Zuflucht und mein Sturm erschienen). Geschrieben hat es die indische Autorin Arundhati Roy, es ist ihr dritter großer Roman. Aber eigentlich ist es gar kein Roman, sondern es ist eine Hass- und Liebenserklärung an ihre gerade verstorbene Mutter, Mary Roy, in und mit der die eigene Biographie, als Mensch und als Autorin, untrennbar verstrickt und verhakelt ist. Denn Mary Roy war eine große indische Frau: Sie gründete eine Schule praktisch aus dem Nichts im bettelarmen Kerala, die wuchs und gedieh und heute als pädagogisches Vorzeigeprojekt gilt; und sie kämpfte für Frauenrechte bis vor das oberste indische Gericht, mit Erfolg. Aber Mary Roy war, das zeigt das Buch ihrer Tochter gnadenlos, ein Monster. Bei ihrem Tod wurde sie als eine Art Nationalheilige gefeiert, die Menschen säumten die Straßen und weinten; aber privat war sie zweifellos ein Monster, und zwar als Mutter wie als Mensch.
Mary Roy hatte zwei Kinder, beide aus einer von Anfang an zum Scheitern verurteilten kurzen Ehe, beide eher ungewollt, vor allem die später so berühmt gewordene Tochter. Beide misshandelte sie von Jugend an, physisch genauso wie seelisch; jedes deutsche Jugendamt hätte ihr sofort das Sorgerecht erzogen (genauso wie jedes Arbeitsgericht sie verurteilt hätte wegen konstanter und krasser Misshandlung ihrer Angestellten; sie warf beispielsweise gern mit Geschirr um sich). Das alles schildert Arundhati Roy in ihrem Buch, sie erspart der Leserin nichts, sie erspart sich selbst nichts dabei – nicht die endlosen Beschimpfungen und Herabwürdigungen, nicht die ewigen Vorwürfe und die geradezu monomanische Egozentrik und Exzentrik einer Frau, die selbst ihr schweres chronisches Asthma niederrang und es überlebte, Jahrzehnte lang. Doch Arundhati Roy liebt dieses Monster, sie kann es nicht ändern; sie liebt es als Kind, das für die Mutter atmen will, ihre eigene Lunge dafür hingeben, wenn die Mutter nur wieder Atem bekommt; sie liebt ihren Kampfgeist, ihren grenzenlosen Idealismus für die richtige Sache, auch: ihren Freiheitswillen und ihre Unkonventionalität im Denken. Kann man ein Monster als Mutter lieben, und: Was macht das mit einem?
Natürlich gibt es Zeiten der Trennung und des vollständigen Zerwürfnisses. Als die junge, vollständig mittellose Arundhati nach Delhi kommt, einem Monster von Stadt, hat sie den ersten Bruch vollzogen. Sie lebt in (die gehäuften Un-Adjektive sind unvermeidbar) unbeschreiblicher Armut; sie spricht nicht die Sprache der Stadt (Indien hat keine Einheitssprache, außer dem kolonialen Englisch); sie hat die ersten Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch schon in weiteren Kreis ihrer eigenen Familie gemacht. Aber wenn sie eines von ihrer Mutter geerbt hat, dann deren unbesiegbaren Lebenswillen und die unglaubliche Energie, mit der sie nun ihre eigenen, selbständigen Ziele verfolgt: Architektur studieren, um mit begrenzten Mitteln Lebensräume zu gestalten; sich für verfolgte Minderheiten und ökologische Projekte einzusetzen; mit den verfolgten Maoisten Indiens durch den Dschungel zu streifen und darüber zu schreiben; alle Drohungen gegen ihr Leben und ihre Person zu ignorieren und immer weiter zu schreiben über all das, was sonst nicht gesagt werden darf in Indien und anderswo. Arundhati Roy ist, zweifellos, wie ihre Mutter eine Aktivistin im guten wie im schlechten Sinne des Wortes; aber sie ist vor allem, wie jede weiß, die eine ihrer Romane gelesen hat (Der Gott der kleinen Dinge; Das Ministerium des äußersten Glücks), eine geborene und großartige Autorin.
Wie sie zu dieser Autorin wird: Auch das schildert das Buch, und es ist eine ebenfalls in gleichem Maße erschreckende wie erhellende Geschichte. Denn zweifellos zehrt das Schreiben von Roy genauso wie ihr Aktivistentum aus den dunklen Quellen der Misshandlung, der privaten wie der politischen. Ihre Roman entstehen über mehrere Jahre hinweg, in denen sie ihr Leben und ihre Figuren kaum noch auseinanderhalten kann. Die Texte schreiben sich, so bemerkt sie auch selbst, eher durch sie hindurch, sie reißen sie mit, und sie kann sie erst schreiben, als sie in ihrem Inneren schon praktisch vollständig vorliegen und dann, mit der Gewalt eines Dammbruches, nach außen drängen (all das merkt man bei der Lektüre, man wird, so man sich in den Strudel hineinwagt: mitgerissen). Frau muss nicht so schreiben, so existentiell, so gefährlich und gewaltsam; aber sie kann es und muss es vielleicht, wenn die Mutter ein Monster ist und selbst der früh gewonnene Booker-Preis und all die folgende Berühmtheit und das viele Geld die Wunden nicht heilen können, die Mother Mary geschlagen hat.
Trotzdem ist das Buch, und das muss man betonen, weil es überhaupt nicht selbstverständlich ist, weder wehmütig noch exhibitionistisch. Es ist streckenweise unglaublich komisch, weil auch das eine der Quellen von Arundhati Roys Schreiben (und wahrscheinliche eine ihrer wichtigsten Überlebensstrategien) ist. Es schreibt nicht abstrakt über Gefühle, sondern zeigt sie bei der inneren Arbeit und in ihren äußeren Ausdrucksformen (die für blasse Europäerinnen oft fremd sind). Es fragt immer wieder die gleichen Fragen (wie kann man ein Monster lieben, selbst wenn es die eigene Mutter ist? was habe ich von diesem Monster in mir?), es zweifelt immer wieder an sich selbst (darf man so über seine Mutter schreiben? Kann man einem derartig überlebensgroßen Charakter überhaupt schreibend gerecht werden, vor allem als Tochter?). Und nicht zuletzt: Es umfasst eine lange Zeitspanne nicht nur persönlicher, sondern auch indischer und damit auch: Weltgeschichte.
Dabei, obwohl das nirgends so explizit gesagt wird, schwingt immer mit: Das noch größere Monster ist Mother India. Ein Staat, in dem ethnische und religiöse Konflikte seit seiner Gründung immer wieder zu unvorstellbar blutigen Massakern geführt haben; ein Staat, in dem das Kastensystem lebt und es immer noch Unberührbare gibt; ein Staat, in dem die Frauen bis vor kurzem systematisch politisch und rechtlich – die Geschichte Mary Roys und ihrer Prozesse zeigt es – unterdrückt wurden; ein Staat, in dem (wie überall auf der Welt) kapitalistische Interessenpolitik zu Umweltzerstörung und Ausbeutung führt; ein Staat, der von skrupellosen Politikern seit einiger Zeit gezielt in einen nationalistisch-hinduistischen Größenwahn getrieben wird. Und ein Land, das Arundhati Roy ganz offensichtlich liebt, genauso wie sie das Monster ihrer Mutter liebt; weil es, neben ihrer Mutter, die zweite große Quelle ihres Schreibens ist. This is India, my Dear, so hatte ihr ein überheblicher Beamter einmal entgegengehalten, als sie wieder einmal die übliche Diskriminierung als Frau erlebte; aber Roy nimmt die Formel auf und dreht sie immer wieder genüsslich in ihr Gegenteil: Indien ist alles – und das Gegenteil davon. This is India, my Dear, so hatte ihr ein überheblicher Beamter einmal entgegengehalten, als sie wieder einmal die übliche Diskriminierung als Frau erlebte; aber Roy nimmt die Formel auf und dreht sie immer wieder genüsslich in ihr Gegenteil: Indien ist alles – und das Gegenteil davon.
Ihre Romane sind deshalb, wenn es so etwas gibt: kulturell unübersetzbar. Aber vielleicht kann man, wenn man sich in die Gesellschaft von idealistischen Monstern wagen mag und sich nicht davor fürchtet, dass sich ab und zu eine kalte Motte auf das eigene Herz setzt (so beschreibt Roy ihre Abhärtungstechnik gegenüber den kontinuierlichen Misshandlungen), in der Lektüre das eigene innere Indien entdecken, ein schlafendes Monster? Es ist wild, ungezähmt und – großartig.
Arundhati Roy: Mother Mary Comes to Me. Deutsch als: Meine Zuflucht und mein Sturm. Übersetzt von Anette Grube. Fischer Verlag 2025
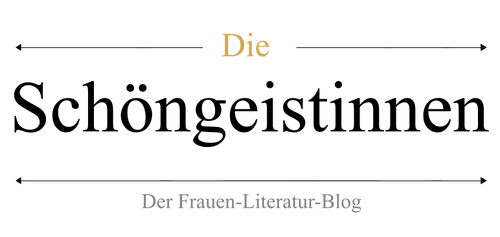

Comments: no replies