I. Die Parzen bei der Arbeit
Sie waren drei. Oder waren sie in eigentlich nur Eine, die sich in drei Gestalten zeigten? Nein, sie waren drei gewesen, von jeher. Drei, wie: die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Drei, wie die Geburt, das Leben und der Tod; drei wie der Anfang, die Mitte und das Ende. Aller guten Dinge sind drei, scherzten sie unter sich gelegentlich, vor allem dann, wenn die männlichen Götter wieder einmal in ihren Zweiheits-Wahn verfallen waren und von Schwarz und Weiß, Gut und Böse und Sein und Nicht-Sein fabulierten, wie sie es so gern taten. Nein, sie waren drei, und sie waren Frauen; und sie hatten schon viele Namen gehabt, und viele Frauen hatten zu ihnen aufgeschrien seit Anbeginn der Welt, wenn sie in den Schmerzen der Geburt darniederlagen. Denn sie waren der Anfang, das Mitte und das Ende; sie waren Geburt, Leben und Tod und die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.
Atropos, die älteste und erste der Drei saß zuhause und spann. Es war ihr Hauptgeschäft, von jeher: ein Garn zu verfertigen, das den Lebensfaden aller Lebewesen bilden würde. Mit den verschiedensten Materialien hatte sie schon gearbeitet; sie hatte Fasern von Tieren, von den feinsten bis zu den gröbsten, ebenso versponnen wie Fasern von Pflanzen, von unterschiedlichster Konsistenz und Haltbarkeit. Vor einiger Zeit hatte Zeus allerdings versucht, sie auf sogenannte Kunstfasern zu verpflichten. Sie hätten große Vorteile, seien billiger in der Herstellung und von äußerster Haltbarkeit; zudem könne so besser sichergestellt werden, dass es möglichst gerecht hergehe bei der Herstellung der Fäden. Am besten nämlich, so hatte er in seinem üblichen überheblichen Ton dahergeschwafelt, sei es, wenn jeder Faden aus dem exakt gleichen Material sei und von völlig identischer Länge; niemand würde sich dann bei ihm beschweren zu können, bei der Schöpfung zu kurz gekommen zu sein oder, wie er auch gern sagte: eine Niete gezogen zu haben! Dann hatte er Hephaistos, seinen alten Erfüllungsgehilfen, dieses neue Material herstellen lassen, aus welch unnatürlichen Stoffen und mit welchem Hexenwerk auch immer. Es fühlte sich falsch und kalt an, wenn man es berührte; es hatte nicht das Leben in sich, das ihre Fasern hatten, je nachdem, ob sie von einer empfindlichen Seidenraupe oder einem wolligen Schaf kamen, von einem schlichten Hanf oder einer exquisiten Kaschmirziege. Und sie fühlten sich immer gleich an, diese künstlichen Fasern, selbst unter ihren äußerst fühlsamen und für die feinsten Strukturen empfindlichsten Hände. Nein, sie wollte nicht damit arbeiten; und es war ihr ein Leichtes, Hephaistos auf ihre Seite zu ziehen und die Pläne des Herrschers zu unterlaufen – schließlich waren sie die Parzen, sie herrschten über alles Geschaffene, und also auch: über die Götter! Seit neuestem allerdings hielt ihr nun Hephaistos ständig Vorträge über etwas, das er „nachwachsende Rohstoffe“ nannte; aber auch das würde vergehen, wie noch jede neue Mode auf dem Olymp. Zeit, das war es, was sie, die uralten Parzen, hatten im Unterschied zu den neuerdings immer hektischer auftretenden olympischen Göttern; sie waren die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, und sie hatten alle Zeit der Welt! Sie waren das Schicksal, und was war das Schicksal denn, wenn nicht: das Recht auf eine eigene Geburt, einen eigenen Lebensverlauf und einen eigenen Tod? Und wer war eigentlich um aller Götter willen auf die Idee gekommen, dass nur die Gleichheit aller Gerechtigkeit gewähren könnte? Es musste –
Aber an dieser Stelle, so sagt die Geschichte, wurde Atropos abberufen, zu einer besonders schweren Geburt. Zum Glück jedoch kommt nun Lachesis herein, die zweite der Drei, um die von Atropos hergestellten Lebensfäden zu verhaspeln. Zuvor hatte sie noch, wie jeden Tag, die Welteiche sorgfältig vom Schlamm des Vortages befreit und sie mit dem Wasser aus der Heiligen Quelle gewässert (es war ein ziemlich widerwärtiger Vortag gewesen, und sie waren sich alle einig, dass der tägliche Schlamm inzwischen geradezu monströse Ausmasse und eine besonders widerwärtige Konsistenz angenommen hatte, es waren gerade wieder diverse neue Kriege ausgebrochen auf Erden). Auch auf Lachesis hatten Zeus und Hephaistos immer wieder eingeredet: Es sei an der Zeit, zu neueren, viel komplizierteren, aber so viel effizienteren Haspeln überzugehen; nur so könne sichergestellt werden, dass alle Garnstränge möglichst von gleicher Dicke, identischer Wicklung und ebenmäßiger Haltbarkeit seien! Und genauso wenig wie Atropos hatte sich Lachesis von den Predigten der Männer beeinflussen lassen. Zugegeben, trotz aller Mühen von Atropos war das Garn von immer schlechterer Qualität inzwischen. Und es kam tatsächlich vor, dass Lachesis sich verhaspelte, dass die Stränge und Knäueln schon beim Aufwickeln zerfaserten oder sich verknoteten, und am Ende: kaum genug Zusammenhalt hatten, um eine gute Gestalt annehmen zu können. Aber manches Mal gelangen ihr auch grandiose Stränge, mit denen sie außerordentlich zufrieden war und die sich als über die Maßen haltbar erwiesen; es waren, natürlich, nur einzelne, aber das war immer so gewesen und würde immer so sein. Doch dann fiel ihr ein, dass sie noch die Stäbe schneiden musste für das abendliche Loswerfen der Runen; und so machte sie sich auf den Weg.
Derweil kommt Klotho herein, die Dritte im Bunde. Sie hat vorher den Hund gut angebunden, damit er die Sterne nicht über Nacht auffrisst und das Universum zusammenbricht, wie jeden Abend. Voller Eifer ergreift sie ihre Schere, um die fälligen Lebensfäden abzuschneiden, mit einem schnellen, energischen Schnitt, so wie es sein sollte. Es ist kein böser Wille dabei, sondern Klotho erfüllt nur das Los, so, wie es gefallen ist und wie es die Schriftrollen verzeichnet haben. Doch auch sie hat in letzter Zeit immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Die Scheren, die Hephaistos ihr regelmäßig liefert, sind auf mysteriöse Weise stumpfer geworden, und nun muss sie oft Fäden, die schon lange fällig gewesen wären, mühsam zerfasern und mehr auseinanderreißen als zerschneiden. Der Prozess ist sogar für sie selbst schmerzhaft, die quälende Langsamkeit, das endlose Auseinanderdehnen von Fasern, die schon längst getrennt sein wollen und sollen, aber nicht auseinanderfallen dürfen, in Frieden und Fühllosigkeit. So war es nicht in den Schriftrollen verzeichnet gewesen!
Und gerade, so hatten sie von Hermes gerüchteweise gehört, hatte Zeus in seinem männlichen Hochmut und seinem göttlichen Übermut Hephaistos eine neue Büchse anfertigen lassen. Es war ein kleiner schwarzer Kasten, aus einem ganz kalten und künstlichen Material; und in ihm steckte, so hatte es Hermes ihnen erklärt, alle Klugheit, alles Wissen und Können der ganzen Welt! Sein bester Trick sei es, dass er Wesen erzeugen konnte, die niemals geboren worden waren; für die es also auch kein Los gab und keine Schriftrollen, und die deshalb: niemals sterben würden. Hermes hatte ein wenig verschmitzt gegrinst dabei, wie es so seine Art war; wahrscheinlich glaubte er selbst nicht an diese dumme kleine schwarze Box, und seine eigenen Tricks waren definitiv unterhaltsamer als eine dumme kleine schwarze Box, die menschenähnlich sprechen konnte. Die drei Schwestern allerdings sahen das Gerät heimlich an, und sie sahen dreieinig in ein unendlich tiefes schwarzes Loch. Denn niemals sterben zu können: War das nicht der schrecklichste Fluch von allen? Ohne Geburt und ohne Tod und ohne Zeit und Entwicklung und ohne Gestaltung zu existieren, ohne jemals gelebt zu haben? Und was würde passieren, mit der Welt und all ihren Lebewesen und den Menschen und den Göttern darinnen, wenn es nur noch solche schwarzen Kisten geben würde, weil die Menschen – die Schwester sahen es seit einiger Zeit schon – nicht nur nicht mehr sterben wollten, sondern auch immer weniger gebären?
Mit den letzten Menschen würde auch das Schicksal sterben, das dreieinige; und die drei Schwestern wussten, dass sie ganz am Ende selbst sterben würden; dass ihre eigene Schere sie zerstören würde, den letzten Faden von der Haspel reißen und dann zerfasern, zerfransen, zergehen im Chaos. Der Baum würde von der Wurzel her verfault sein, der Hund hätte alle Sterne gefressen, und niemals mehr würde eine Frau im Geburtsschmerz aufschreien. Aber sie wären keine Schicksalsgöttinnen gewesen, wenn sie nicht gewusst hätten, dass auch sie selbst ein Schicksal hatten, mit Anfang und Mitte und Ende; und dass unter dem Baum ganz sicher ein anderer Baum gewachsen war und wachsen würde, mit anderen Wurzeln und Zweigen, und dass der Hund – nur eine der unzählbaren Gestalten des Lebens war, das das Universum bevölkerte. Wie der Mensch. Wie die Götter. Wie das Schicksal.
II. Mythologischer Hintergrund
Alle Mythologien (jedenfalls die bekannteren) kennen weibliche und männliche Göttinnen. Meistens ist der Chef natürlich männlich (Zeus, Jupiter, Thor), hat ein handliches Set von Blitzen zur Einschüchterung und darf alle seine untergeordneten Kollegen beliebig herumkommandieren (und beliebig viele Frauen vergewaltigen, mehr oder weniger). Die untergeordneten Kollegen sind so eine Art Ressortleiter; einer ist zuständig für Krieg und Gewalt, eine für Liebe und Schönheit (komischerweise sind sie bei den Griechen verheiratet) und so weiter – es ist eine Art Götter-Kabinett. Darunter kommen dann die Heroen und Halbgötter als eine Art Referenten. Aber es soll hier gar nicht um die Mythologie als Ursprungstopos der Bürokratie gehen, das ist eine andere Geschichte. Sondern um eine kleine Besonderheit, die diese schoengeistin in ihrem Urlaub auf dem sehr fremdartigen und fernen Island ansprang: nämlich die isländischen Schicksalsgöttinnen aus der (eigentlich) sehr eigenständigen und reichen altnordischen Literatur des Mittelalters (die Isländer sind bis heute, so versichern schriftliche und mündliche Führer unisono, ein Volk der Schreiber, und die Wikinger wurden offenbar nicht nur mit der Axt, sondern auch mit der Feder in der Hand aufgezogen). Drei sind es an der Zahl, sie heißen Urd (das Schicksal), Verdandi (das Werdende) und Skuld (Schuld; das was zukünftig sein soll). Sie wohnen an der Wurzel der Weltenesche Yggdrasil, die sie mit Wasser aus der Urdquelle pflegen. Und eine ihrer Hauptaufgabe ist es auch, Müttern bei der Geburt beizustehen.
Drei sind nun auch, was etwas bekannter ist, die lateinischen Parzen, und sie sind die Nachfahren der drei griechischen Parzen. Die Parzen heißen Nona (die Neunte) und Decima (die Zehnte), nach den letzten Monaten der Schwangerschaft. Die Dritte, Parca, ist die Geburtshelferin. Sie haben zudem die gleichen Aufgaben wie die Moiren: Nono spinnt wie Klotho den Lebensfaden; Decima entscheidet wie Lachesis über den Lebensweg und das Geschick; und Parca und Atropos schneiden den Lebensfaden durch und beenden so das Leben. Es gibt auch noch eine slawische Variante, die drei Zoryas, die verschiedene Sterne verkörpern und den bösen Hund bewachen, damit er nicht die Sterne frisst; aber das führt schon ins sehr Entfernte. Wir enden deshalb mit Goethe, der die drei Parzen in Faust II sich selbst vorstellen lässt:
III. Goethe, Faust II
Atropos.
Mich die älteste zum Spinnen
Hat man dießmal eingeladen;
Viel zu denken, viel zu sinnen
Gibt’s beim zarten Lebensfaden.
Daß er euch gelenk und weich sey
Wußt’ ich feinsten Flachs zu sichten;
Daß er glatt und schlank und gleich sey
Wird der kluge Finger schlichten.
Wolltet ihr bei Lust und Tänzen
Allzu üppig euch erweisen,
Denkt an dieses Fadens Gränzen,
Hütet euch! er möchte reißen!
Klotho.
Wißt! in diesen letzten Tagen
Ward die Scheere mir vertraut;
Denn man war von dem Betragen
Unsrer Alten nicht erbaut.
Zerrt unnützeste Gespinnste
Lange sie an Licht und Luft,
Hoffnung herrlichster Gewinnste
Schleppt sie schneidend zu der Gruft.
Doch auch ich im Jugend-Walten
Irrte mich schon hundertmal;
Heute mich im Zaum zu halten
Scheere steckt im Futteral.
Und so bin ich gern gebunden,
Blicke freundlich diesem Ort;
Ihr in diesen freien Stunden
Schwärmt nur immer fort und fort.
Lachesis.
Mir, die ich allein verständig,
Blieb das Ordnen zugetheilt;
Meine Weife, stets lebendig,
Hat noch nie sich übereilt.
Fäden kommen, Fäden weifen,
Jeden lenk’ ich seine Bahn,
Keinen laß ich überschweifen,
Füg’ er sich im Kreis heran.
Könnt’ ich einmal mich vergessen
Wär’ es um die Welt mir bang;
Stunden zählen, Jahre messen,
Und der Weber nimmt den Strang.
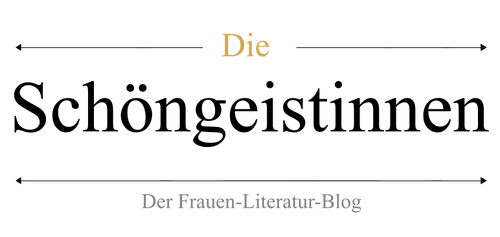

Comments: no replies