Zum E-Mail-Roman „The Appeal“ von Janice Hallett
E-Mails können entlarvend sein. Wie entlarvend, das kann man aus dem Roman The Appeal (2021) der englischen Autorin Janice Hallett lernen. Das Buch hat eigentlich keine Werbung nötig; in England stand es auf allen Bestsellerlisten, und wer die ersten Seiten liest, ist gefangen in einem mehrfach verknoteten Rätsel und einem Netzwerk (im durchaus doppelten Sinn) von Beziehungen, die bei allem oberflächlichen digitalen Austausch untergründiger sind, als man geahnt hätte. Es geht um eine englische Amateur-Theatergruppe mit all ihren persönlichen und sozialen Verstrickungen; es geht um die unaufhaltsame Dynamik einer Crowdfunding-Initiative für ein krebskrankes Kind (das ist der eine Sinn des titelgebenden Appeal: ein Spendenaufruf); es geht um die Probleme von Hilfsorganisationen im fernen Afrika, deren Nutzen wie potentiellem Schaden (auch das natürlich etwas, was mit appeals arbeitet) – und das alles ist mit ebenso großer Sachkenntnis wie Professionalität geschildert. Was aber die Lektüre darüber hinaus interessant macht, und zwar auch für diejenigen, die sich weder von Krimis einfangen lassen wollen noch von der Identifikation mit menschlich-allzumenschlichen Protagonisten in all ihren Alltäglichkeiten wie Lebenskrisen: Das ist die gelungene Erneuerung eines altmodischen Genres – nämlich des empfindsamen Briefromans des 18. Jahrhunderts (Goethes Die Leiden des jungen Werthers sind wohl das bekannteste Beispiel) – in einer Form, die oberflächliche Einfachheit mit literarischer Komplexität verbindet.
Das klingt zunächst nur wie ein Lehrstück in angewandter Literaturgeschichte und Poetik und damit allerhöchstens interessant für ältliche Literaturprofessorinnen-cum-Bloggerin oder sehr unerschrockene Literaturwissenschaftsstudentinnen. Ist es aber nicht. Und damit kommen wir zurück auf unsere ungedeckte Anfangs-Behauptung: Ist es nicht gerade hier und heute für uns alle aufschlussreich, wie entlarvend die alltägliche Sprache und wie verräterische sprachliche Eigenheiten sind? Wie psychologisch markant digitale Selbstdarstellungsweisen? Wie aussagekräftig Fragen der strategischen Privatkommunikation (wer schreibt wem wann wieso und mit wem im CC?)? Denn all das müssen die beiden jungen Anwältinnen lernen, die den Appeal (also: die Berufungsklage auf ein strafrechtliches Urteil, zweite Bedeutung) vorbereiten. Sie kennen die Personen nicht, sie haben nur die Aktenlage, und das ist: die gesamte elektronische Kommunikation aller beteiligten Personen. Und so werden sie Profiler, Kommunikationswissenschaftlerinnen, Spurensucherinnen, Psychologinnen, Sprachanalytikerinnen. Und mit ihnen lernt die Leserin – lesen: gründlich lesen, mit geschärftem Blick und Ohr lesen, detektivisch lesen. Im Wissenschaftskleid nennt man das „Hermeneutik“ (Deutungskunst); Hermeneutik vollzieht sich aber überall, wo Menschen einander verstehen wollen oder müssen. Hermeneutik ist: Zeichen deuten, die kleinsten ebenso wie die größten; und lernen, dass Zeichendeutung immer ein gefährliches Geschäft ist, das Missverständnis lauert hinter jedem Emoji (es gibt übrigens keine Emojis im Roman, was eigentlich schade ist), man kann unter-deuten wie über-deuten, und am Ende fällt jemand ein Fehlurteil und es wird ein Appeal fällig. Man muss aber deuten, es gilt der hermeneutische Imperativ: Ohne Deutung keine Verständigung. Wie also deutet man richtig?
Badeschaum, Entwicklungshilfe und Drehbücher – die Autorin Janice Hallett
Die Autorin Janice Hallett, um mit einer strategischen Abschweifung zu beginnen, hat ihr Geschäft als Autorin gelernt, und zwar von der Pike auf. Sie hat nicht nur englische Literatur studiert, sondern auch Drehbuchschreiben gelernt; erste Berühmtheit erlangte sie mit einem Drehbuch über eine Pandemie (Retreat), der Film entstand neun Jahre, bevor COVID-19 ihn bewahrheitete (ordentliche Hermeneutik kann in die Zukunft sehen; sie hat die Vergangenheit gut verstanden und ihre Lehren daraus gezogen). Hallett schrieb lange Jahre für Schönheitsmagazine, und in einem Interview hat sie darüber gesagt: „Die meisten Leute haben das Schreiben über Schaumbäder nach zwei Jahren über – ich brauchte fünfzehn Jahre, bis ich mich davon verabschiedete“. Das kann man als mangelnden Mut und schwaches Selbstbewusstsein deuten, ein weitverbreitetes Problem weiblichen Schreibens; andererseits zeigt es, vielleicht, ja auch eine erstaunliche Kreativitätsbreite: Wer fünfzehn Jahre (offensichtlich erfolgreich) über Schaumbäder schreibt, ist entweder ein chronischer Wiederholungstäter oder von meisterhafter Erfindungsgabe! Danach wurde Hallett als Texterin für die englische Regierung tätig, unter anderem für das Entwicklungshilfe-Ressort (was ihre relativ intimen Kenntnisse dieses heiklen politischen Bereichs erklärt); auch das eine harte Schule des Schreibens, ein „Feuerbad“, wie sie selbst gesagt hat, am Puls der Zeit und unter dem gnadenlosen Blick der Öffentlichkeit. Lange Jahre war sie zudem in einer Amateur-Theatergruppe tätig, und das in jeder vorstellbaren Funktion und Rolle. Und erst dann setzte sie sich irgendwann hin und schrieb The Appeal (und anschließend schon ein weiteres Buch mit einem ähnlichen, aber variiertem Strickmuster, das ist verzeihlich: The Twyford Cocde), in einem Jahr, ohne Plan, aber mit einer Menge „reverse engineering“ am Ende. Denn man muss ein gutes Buch zuerst sich selbst schreiben lassen, aber dann kann man es, von hinten her, wieder aufrollen und alle Lücken füllen, die das Feuer der Erstinspiration hinterlassen hat (und sei es mit den klassischen red herrings, die jeder ordentliche Krimi ausstreut: sie führen ins hermeneutische Nichts, und natürlich hat der Appeal jede Menge rote Heringe).
Der polyperspektivische Brief- und E-Mail-Roman, oder: detektivische Hermeneutik
So also entstand The Appeal, das Werk einer lang geschulten, hochprofessionellen Autorin – aber das allein reicht zwar vielleicht für einen Bestseller, aber nicht für ein interessantes Buch. Interessant wird es vielmehr dadurch, dass es die Leserin alle wesentlichen Erfahrungen selbst machen lässt, in großer Freiheit, aber nicht in unbegrenzter Willkür. Und so lernt man langsam beim Lesen die Figuren kennen, über die man nichts weiß – wie im „klassischen“ Briefroman kann eine Figur ja nicht eingeführt werden über eine Beschreibung oder eine Charakterisierung; nein, alles, was wir über jede einzelnen der vielen Figuren wissen können und wissen werden, müssen wir aus ihren eigenen Emails – und natürlich dem, was in anderen Emails über sie gesagt wird – hinausziehen. Wir werden zu Profilern erzogen, Schritt für Schritt; und alle Figuren, die sich nicht in einem der digitalen Medien äußern (es sind zwei der zentralen Figuren des Textes überhaupt), bilden eine gigantische Leerstelle, die noch viel schwieriger zu füllen ist. „Polyperspektivisch“ ist das Fachwort dafür: Die Handlung des Romans setzt sich zusammen aus vielen einzelnen Perspektiven auf das Geschehen; es gibt jedoch keinen Erzähler, der sie für uns einordnet, bewertet, in Zusammenhang bringt.
Doch wir konstruieren nicht nur psychologische Profile beim Lesen, wir rekonstruieren auch ein Geschehen, das teilweise zurückliegt und nur über Erzählungen zugänglich ist. Wir werden nicht nur Detektivinnen, wir werden Geschichtsschreiberinnen und, zu guter Letzt, Anwältinnen ebenso wie Urteilende und Richterinnen in einem Prozess, der nicht nur ein juristischer ist, sondern auch ein politscher und ein moralischer und als solcher unser Urteil verlangt. Zwar liegt am Ende, wie es sich gehört, eine Leiche da, und natürlich wollen wir wissen, wer es war; aber viel interessanter ist (wie in jedem guten Krimi), warum sie da liegt und – vielleicht: wie man es hätte verhindern können?
Die ganze Welt ist eine Bühne, und wir sind die Schauspieler
Vielleicht macht es auch die besondere Anmutung (und das ist der dritte Sinn von Appeal: der Reiz, die Anziehungskraft, und beides spielt durchaus eine Rolle im Figurenvieleck des Textes) des Romanes aus, dass die wesentlichen Akteure Mitglieder einer langjährigen Amateur-Theatergruppe sind, eines ganz besonders eng verwobenen sozialen Mikrokosmos mit eigenem Milieu. All the world’s a stage, das ist zwar ein schon ein sehr zertrampelter Allgemeinplatz, aber es ist auch die Wahrheit: Gerade in unserer digitalisierten Welt spielen viele von uns noch intensiver „Rollen“, als jemals zuvor; betreiben Formen der Selbstdarstellung, die zu einem ganzen zweiten Ich werden können, einem Avatar, der in einer ganzen zweiten Welt – der Welt des Theaters, das das große weite Internet ist – agiert. Macht spielt dabei eine Rolle, Geld spielt eine Rolle, Schönheit spielt eine Rolle, Status spielt eine Rolle – alles wie im „richtigen Leben“. Jemand spielt immer die Hauptrolle, und andere kochen immer den Tee und verteilen die Programme und warten auf ihre Chance, meist vergeblich. Doch in Halletts E-Mail-Roman kommen auch die Teekocherinnen zu Wort; mit den beiden Anwältinnen bekommen wir den ganzen digitalen Schriftwechsel, jedes digitale Pupsen, ungefiltert. Denn: Jede Nachricht ist eine Botschaft, auf irgendeiner Ebene – und nur, wenn wir auch die länglichen, umständlichen, unsympathischen, nervtötenden Botschaften lesen, können wir verstehen. Jede spielt eine Rolle, und das Ganze funktioniert am Ende nur, wenn alle ihren Teil tun. Es ist – wie im Leben, das an uns herantritt mit appeals in ihrem schönen dreifaltigen Sinn: einer Vielzahl von Bitten, Aufrufen und Apellen: von Beschwerden, Mahnungen und Anfechtungen; von Anmutungen, Reizen und Anreizen. Das Leben ist seinem Wesen nach polyperspektivisch; und nur, wer gelernt hat, zwischen seinen Zeilen zu lesen, kann daraus am Ende ein sinnvolles Bild zusammensetzen (für alle anderen gibt es Kaleidoskope).
In deutscher Übersetzung erhältlich unter dem Titel: Mord zwischen den Zeilen. Übersetzt von Sabine Schilasky. Rowohlt Verlag 2021.

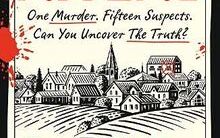
Comments: no replies