Silke Scheuermann wurde 1973 geboren in Karlsruhe und lebt heute in Frankfurt; ihr Gedichtband Skizze vom Gras erschien 2014. Ein Gedicht daraus heißt Akazie und ist eines der wenigen guten Dinggedichte, die es nach Rilke noch in der Literatur gibt:
So bescheiden, dass selbst die Sonne
den Sinn von Stolz hinterfragt, aber ungeduldig,
oh ja, selbst die Aussagen, die sie
über den Winter trifft, sind atemlos,
ein Rauschen, das wenig mit Wind zu tun hat,
vielmehr mit Sprache, stiller Macht. Sie
alle sind als Versprechen zu lesen. Besagen,
dass Serengeti nur eine Station in einem
aufregenden Leben war und sie jetzt
hier ihren Schirm spannt, Silhouette der
Geborgenheit. Nichts endet schnell genug,
kein Tag: da ist immer nur Ungeduld, Warten –
darauf, dass die Sonne endlich einschläft.
Samt ihrer Behauptung: Warten, das
macht nichts, Warten ist Übergang.
Die Natur ist nicht dunkel,
die Welt ist dunkel.

Kurz zum botanischen Hintergrund: Mit Akazie sind die großen Schirmakazien gemeint, die mit ihren mächtigen schirmartigen Wipfeln die afrikanischen Wüsten prägen; deshalb taucht auch die Serengeti hier auf, ein bekannter afrikanischer Naturpark. Das Gedicht spricht also, wieder einmal und Bertolt Brechts Diktum zum Trotz, von Bäumen. Diese Bäume werden zunächst zum Sprechen gebracht, indem sie vermenschlicht werden: Ihnen werden menschliche Tugenden zugesprochen – Bescheidenheit statt Stolz, Atemlosigkeit, Warten. Sie sprechen aber auch selbst; ihr Rauschen wird nicht vom Wind verursacht, sondern ist eine eigene Ausdrucksform. Ihr Gegenpol im Gedicht ist die Sonne, die eher mit dem Stolz verbunden wird, aber auch mit dem Warten; dem Warten darauf, dass die Sonne endlich einschläft, und dass es Nacht wird.
Das Gedicht lässt also die Akazie sprechen, und es tut das in sehr fließenden, gar nicht hermetisch verschlossen auftretenden, vollständigen Sätzen; die Atemlosigkeit und Ungeduld der Akazie wird dabei durch die Enjambements verdeutlicht, mit denen praktisch jeder Vers endet – bis auf eine Zeile im letzten Drittel, wo das Warten durch einen Gedankenstrich symbolisiert wird und eine Stille entsteht. Die Akazie hat viel gesehen, sie hatte ein aufregendes Leben; nun aber steht sie, breitet ihren mächtigen Schirm aus, eine „Silhouette der Geborgenheit“, und kann es nicht abwarten, dass die Sonne endlich untergeht. Warum eigentlich? Das bringt das Gedicht in den letzten vier Zeilen zum Ausdruck, die vom Beschreiben zum Reflektieren übergehen und in einer Art kleinem Rätsel enden. Die Moral der Sonne ist, so sagen sie: „Warten ist Übergang“ – frau denkt an die großen Zyklen und Rhythmen der Natur, auf den Tag folgt die Nacht, auf die Nacht wieder der Tag, es gibt keinen Stillstand, alles ist in immerwährendem Übergang – zeit- und erfahrungsbewährte Floskeln, die auch gern zitiert werden, um Trost zu geben, Geborgenheit in einer sich ständig ändernden Welt. Die Akazie jedoch will davon nichts wissen, sie leugnet das Warten, den Übergang: Denn nicht die Natur ist dunkel, sondern die Welt ist dunkel.
Diese beiden Sätze sind, in ihrer Kombination, nun selbst nicht wenig dunkel. Mein Angebot: „Welt“ ist etwas anderes als „Natur“, insofern Welt die Natur, gesehen durch menschliche Augen, ist. Menschliche Augen jedoch nehmen schon immer eine Interpretation vor; sie sehen niemals nur das, was da ist, was Natur ist ohne Menschen. Menschen sehen deshalb den Wechsel von Tag und Nacht in Begriffen von hell und dunkel; die Natur selbst jedoch ruht in sich selbst, sie ist bescheiden, sie spricht still vor sich hin, und es interessiert sie wenig, was die stolze Sonne so tut an aufregenden Tagen. Kurz gesagt: Übergänge sind für Leute, Menschen, sonnenhungrige. Bäume sind. Hier spricht tatsächlich eine Natur jenseits des Menschen (wenn auch in durchaus menschlichen Begriffen). Dementsprechend tritt auch ein lyrisches Ich (ganz ähnlich war es in den Texten von Marion Poschmann) kaum noch oder gar nicht mehr in Erscheinung!
Noch ein Gedicht von Silke Scheuermann, das nun nicht von Bäumen spricht, sondern von Pflanzen ganz im Allgemeinen und ausgestorbenen im Speziellen; wir sind hier also im Herzen dessen, was Ökolyrik tut. Das Gedicht trägt dementsprechend auch den Titel: Die Ausgestorbenen.
Es sind die Pflanzen in den Schlagzeilen, nicht die auf der Wiese,
in Wäldern und Sümpfen, Gärten und Parks.
Es sind die Pflanzen, die in den Konjunktiv gezogen sind,
weil wir sie umtopften in imaginäre Parks,
Erdgeschichte, Kapitel. Jene, die Neubaugebieten
gewichen sind, Umgehungsstraßen und Kraftwerken,
im Paralleluniversum riechen sie wunderbar,
in diesem nur nach Papier und Listen,
schlechtem Gewissen und hohem Gewinn.
Wir befinden uns tief im Gestrüpp von Schuld,
das über verlorene Schmuckstücke wächst, weggeworfene Ringe,
Fußkettchen aus angelaufenem Silber. Vergeblich verhandeln wir
alte Gefühle, suchen nach Bildern, die sich im Traum bewegen.
In meinem Brustkorb funkelt mein Herz wie ein versteckter
Kressesamen, ein Blättchen Löwenzahn.
Schwaches Licht fällt auf etwas, das an die Wand gezeichnet ist,
und ich sehe, es sind Bilder der ausgestorbenen Pflanzen.
Für einen Augenblick flüstern alle ihre Namen gleichzeitig,
und ihre Farben leuchten noch einmal auf,
leuchten und leuchten, addieren sich zum Frühling,
wie es ihn kaum je gegeben hat,
wie er kaum jemals in Öl existierte oder auf Hochglanzpapier,
wie er niemals in Fabriken hergestellt wird oder Industrieparks,
gebaut auf dem Areal, das einst das ihre war, jetzt
so wild überwuchert von etwas Neuem.
Das Gedicht beginnt damit, dass es Pflanzen heraufbeschwört, die es nicht mehr gibt; Pflanzen, die aus ihrem natürlichen Habitat vertrieben wurden und nun nur noch in Büchern, im Konjunktiv, in imaginären Parks existieren: was man mit einigem Mut zur starken These sogar als Äquivalent zur Naturlyrik lesen könnte, die sozusagen ein einziger imaginärer Naturpark ist, von Lukrez‘ de rerum natura an bis hin zu Brechts Bäumen. Konkret jedoch sind die Pflanzen dem Menschen und seiner Technik zum Opfer gefallen, für die hier die Neubaugebiete, Umgehungsstraße und Kraftwerke genannt werden. Sie haben damit ihre sinnliche Erfahrbarkeit verloren, riechen nämlich nicht mehr nach Pflanze, sondern – nach moralischer Verwerflichkeit: „schlechtem Gewissen und hohem Gewinn“; hier findet sich also eine deutliche ethische Aufladung des Textes, wie sie bezeichnend für die Ökolyrik ist.
Das Gedicht findet an dieser Stelle erst sein Subjekt: Es ist ein lyrisches „Wir“, das sich selbst nicht ausnimmt von der Verstrickung in Schuld und Gewinnsucht; dieses „Gestrüpp von Schuld“ wird anschließend mit einer Reihe von Bildern beschrieben, die interessanterweise aus dem Bereich von Schmuck stammen. Dabei wird der Raum des Gedichts immer weiter ins Innere verlegt, bis es schließlich im „Herzen“ ankommt, das funkelt – aber eben nicht wie ein Schmuckstück, sondern wie ein unscheinbares, aber fruchtbares Stück Natur, ein Kressesamen, ein Blättchen Löwenzahn. Es ist dabei nicht ganz klar, ob das schwache Licht, das nun auf eine Wand fällt, immer noch im Raum des Herzens leuchtet, ich würde es aber annehmen, immerhin gibt es tatsächlich eine physiologische Herzwand im menschlichen Herzen. Die ganze Szene erinnert ein wenig – aber das mag jetzt überinterpretiert sein – an das Platonische Höhlengleichnis; etwas wird mit einem schwachen Licht auf eine Wand projiziert, erkennbar sind aber nur noch die Bilder, nicht mehr die realen Gegenstände (für die man die Höhle verlassen müsste). Dafür spricht auch, dass die ausgestorbenen Pflanzen alle gleichzeitig ihren Namen flüstern, also ihr Wesen, ihre Idee zum Ausdruck bringen; zudem leuchten sie noch einmal auf, zeigen ihre Farben und summieren sich zu einem idealen Frühling. Denn es ist ein Frühling, „wie es ihn kaum je gegeben hat“ – nicht in der Malerei, nicht auf industriellen Abbildungen; ein Frühling, der schließlich überhaupt nicht technisch produziert werden kann in Fabriken oder Industrieparks. Die Rede von Industrie-Parks ist dabei durchaus ironisch zu verstehen: Es sind keine imaginären Parks, sondern sehr reale, die aber eine eigene Art von Natur entwickeln: ein Areal, „so wild überwuchert von etwas Neuem“. Die Industrie ist der neue Wildwuchs; und vielleicht kann man ja durchaus einen positiven Aspekt darin entdecken, dass hier immerhin noch etwas Wildes wuchert, also lebendig ist, das ja vielleicht auch seine eigenen Darstellungsformen finden mag. Ob es die der traditionellen Naturlyrik sein werden, ist zweifelhaft; sie lebt jedoch bei Silke Scheuermann immerhin in einem Paralleluniversum weiter, einem imaginären Park, in dem der Frühling farbenfroher und duftiger ist, als er es je in der Realität sein konnte.
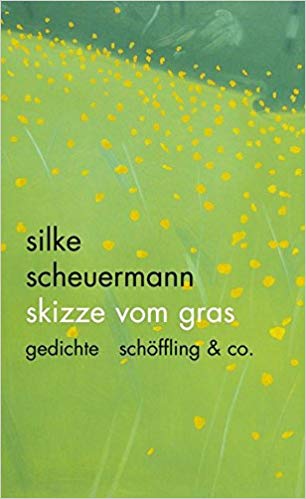
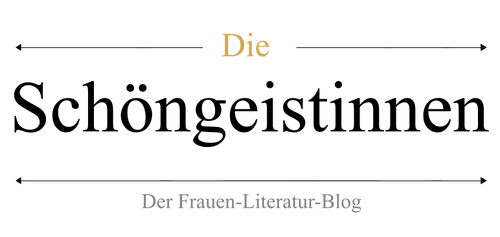

Comments: no replies