Juli Zehs Poetik-Vorlesung
Es ist, als ob man einem Zauberer dabei zuschaut, wie er seine Tricks erklärt. Es ist aber eine Zauberin, auch wenn das in diesem speziellen Fall ziemlich egal ist, denn der Effekt ist der gleiche: Man stellt ziemlich schnell fest, dass man es selbst trotzdem nicht hinkriegen würde; jedenfalls nicht ohne jahrelange Übung und einen gewissen, wahrscheinlich angeborenen Sinne für – nun ja, die Magie des Alltäglichen und die Zauberkraft der Sprache? Nein, Schreiben nach der Lektüre von Juli Zehs Poetik-Vorlesungen Treideln ist schmerzhaft. Man fühlt sich klein und dumm, wie eine der vielen Figuren, die in diesen Poetik-Vorlesungen auftauchen als schlechte Beispiele für den sekundären Umgang mit Literatur. Aber andererseits war die Lektüre sehr, sehr lustig. Und sehr, sehr aufschlussreich für alle, die sich nicht nur für Schreiben, sondern auch für Lesen und die Literatur insgesamt (die etwas anderes ist als das Schreiben, wie wir lernen) und darüber hinaus für alle Arten von Lebensklugheit und intellektueller Großzügigkeit und sprachlicher Brillanz interessieren. Also, überwinden wir den inneren Minderwertigkeitskomplex! Bekennen wir uns zur eigenen Zweit- und Dritt- und Viertrangigkeit, stehen wir dazu, Bannerträgern des Sekundären, Nachgetragenen im literarischen Betrieb zu sein! – und versuchen mit schwereren Fingern und in ungeschickteren Sätzen zu erklären, warum man diese Poetik-Vorlesungen lesen sollte, auch wenn der Titel etwas fremdartig ist und das Genre – naja, eher akademisch-abschreckend! Es ist aber nicht nur eine Poetik, sondern auch eine Anti-Poetik; und ein Roman, und eine Satire, garniert mit Geschichten aus dem eigenen Leben und dem Leben fiktiver Romanfiguren (die Doppelung ist beabsichtigt). Es ist –
Aber beginnen wir von vorn: Treideln – so heißt das Buch, und sein Anlass ist die Einladung der Frankfurter Goethe-Universität an Juli Zeh, Autorin und Verfassungsrichterin in Brandenburg, in der renommierten Reihe ihrer Poetik-Vorlesungen zu sprechen (oder, um mit Juli Zeh zu sprechen: Herta Müller war auch schon da, und das ist das Argument jedes Verlegers dafür, eine solche Einladung einzunehmen: „Herta Müller war auch schon da!“ Wie der sagenhafte Igel, dem der arme Hase immer nur hinterhersprinten kann). Aber jetzt sind wir schon wieder vorgesprintet, denn eigentlich wollten wir noch ein wenig beim Titel verweilen: „Treideln“ – was ist denn das? Altertümliches Wort, auf jeden Fall. Vielleicht sehen einige von uns, die Älteren wahrscheinlich, ein recht idyllisches Flussufer vor dem inneren Auge, ein noch nicht maschinenbetriebenes Schifflein schwimmt darauf, und am Ufer ziehen es Pferde stromauf. Oder Menschen. Dazu ein paar fun facts, Wissen von Wikipedia: Uralte Kulturtechnik, schon in Mesopotamien nachweisbar; nach der Abschaffung der Todesstrafe durch die aufgeklärten Monarchen des 18. Jahrhunderts auch gern als Strafe verhängt! Heute wandert die Menschheit auf alten Treidelpfaden und freut sich des ruhig fließenden Gewässers. Goethe kannte das Wort noch nicht, in der Literatursprache ist es, wie eine oberflächliche Recherche zeigt, praktisch nicht vorhanden; das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache zeigt in der Häufigkeitsstatistik von 1600 bis 2000 praktisch eine flatline knapp über 0. Treideln, also: Ist vergessen. Klingt aber hübsch, zweifellos; hat etwas Onomapoetisches, simuliert nämlich lautlich die Tätigkeit, die es bedeutet, wenn auch ins Verniedlichende gewendet: eine langsame, schlendernde, gleichwohl zielgerichtete Tätigkeit unter Kraftanstrengung. Das Schiff bewegt sich, mühevoll, stromaufwärts (stromabwärts fährt es von alleine). Außerdem heißt so eine Romanfigur, erfunden von Juli Zeh, nämlich Karl Treidel; geplant als Titelheld eines Romanes, doch leider – verstorben vor der Zeit; die Poetik-Vorlesungen enden aber mit einem kleinen Hoffnungslicht (denn das, so Juli Zeh, stellt sie immer auf in ihren häufig düster endenden Texten, es sieht nur keiner): „Treidel ist tot. Es lebe das Treideln!“
Treideln wir also ein wenig mit ihr! Ziehen wir an den schweren Leinen einer Poetik, die gleichzeitig eine Anti-Poetik sein will und uns im Wesentlichen dabei zuschauen lässt, live und ungewaschen, wie die Autorin scheitert an den ihr auferlegten Lasten. Sie will keine Poetik-Vorlesung verfassen, weil sie das Schreiben von theoretischen Aufsätzen über das Schreiben von Literatur für Zeit- und Ressourcenverschwendung hält: „Poetik ist, wenn man eine Schreibkrise hat. Wenn man mangels Stoff zum Schreiben am liebsten übers Schreiben schreibt“. Sie kämpft darum mit ihrem Verleger: „das kannst du vergessen. Kommt nicht in Frage. Man ist entweder Autor oder Poetikbesitzer. Ich bin doch nicht mein eigener Deutsch-Leistungskurs. Ohne mich!“ Sie wechselt liebevolle, aber entschiedene Noten darüber mit ihrem ebenfalls schreibenden Ehemann, dem „Chef“, gezeichnet mit „dein Vorzimmer“; er schenkt ihr einen E-Book-Reader und damit die Idee sowohl für den Treidel-Roman als auch für die Poetik-Vorlesung, die keine Poetik-Vorlesung ist, sondern ein Dokumentarfilm über das Nicht-Verfassen (und Verfassen) einer Poetik-Vorlesung. Zwischendurch schreibt sie Briefe an die Abfallberatung des Landkreises Mittelbrandmark und scheitert bei dem Versuch, eine dringend benötigte zusätzliche blaue Tonne zu bekommen („Ich versichere Ihnen, gern auch eidesstattlich: Vom Glauben bin ich längst abgefallen. Ich habe Logik, Gerechtigkeit und Sinn als menschliche Bedürfnisse erkannt, denen niemals ein realer Zustand entsprechen wird. Ich bin Atheistin, Skeptizistin, manchmal Solipsistin. …. Ich brauche keine Abfallberatung. Auch keine Nachhilfe in Weltschmerz. Sondern nur eine zweite blaue Tonne. Bitte“). Oder sie schreibt an die Deutsche Bahn und an Hoteldirektionen, beides Institutionen, die Handlungsreisende in Sachen Kultur definitiv in den Wahnsinn treiben können und die gegen jegliche Beschwerde bekanntlich vollständig immun sind. Oder sie beantwortet Briefe, die sie im Auftrag des Erzengels Gabriel dazu auffordern, Präsident Obama umzubringen; oder sich für ein Foto-Shooting der Weihnachtskrippe zur Verfügung zu stellen („Leider muss ich kurz vor dem geplanten Shooting zu einer dringenden Weltumseglung aufbrechen und bin erst am Sankt Nimmerleinstag zurück“). Oder sie schreibt an die Gesellschaft für Sprache und Gesellschaft, die um die Verwendung des Isogramms des Jahres (Isogramm, ein total nützlich-unnützes Wort: ein Wort, in dem jeder verwendete Buchstabe nur einmal vorkommt) in ihrem nächsten Roman bittet – eine Anfrage, die die Autorin zunächst unter energischen Hinweis auf die Freiheit der Kunst ablehnt, um sie dann nach Angebot eines Honorars von 500 Euro freudig anzunehmen und gleich noch ein paar schöne Exemplare zum Verkauf anzubieten: „Zylinderkopfwachstum, Malzwhiskyduftproben, Windbachverstopfung“. Sie scheitert auch beim Versuch, die deutsche Steuergerechtigkeits-Logik (kein Isogramm, leider) zu verstehen, die es ihr nahelegt, ein möglichst teures, maximal umweltschädliches Auto zu kaufen, weil man es so gut von der Steuer absetzen kann, während Hunde- oder Pferdefutter oder Kosten für den Unterhalt eines Ehemannes, so nötig dieses alles zur Ausübung einer verdienstvollen Autorentätigkeit sein mag, nicht absetzbar sind. Umfragen, Einladungen zu Vorträgen vor Deutsch-Leistungskursen, Interviewanfragen, noch mehr Interviewanfragen, dazwischen mal wieder die Uni Frankfurt: Nein, Frau Zeh weiß wirklich noch nicht. Sie wird sich aber demnächst äußern, ganz gewiss!
Das ist das satirische Teil, und das liest sich von alleine und geht runter wie Malzwhiskyduftproben (ha!). Der anti-poetisch/poetische Teil hingegen findet im Wesentlichen in der Email-Korrespondenz mit drei Personen statt: einer Germanistin namens Wanda, die auch Gedichte schreibt und gern einen Roman schreiben möchte; einem ehemaligen WG-Mitbewohner namens Holger; und vor allem einem ungenannten Kumpel, genannt „alter Schwede“, Mitstudent am Leipziger Literaturinstitut und noch ein Autor. Mit diesem Trio werden nach und nach alle – nein, nicht alle „relevanten“, sondern ganz altmodisch: alle wesentlichen Fragen und Probleme des Autorendaseins aufgearbeitet; aber nicht theoretisch-trocken, sondern in unterschiedlichem Ton und in unterschiedlicher Abstraktionshöhe oder -tiefe, und schließlich: immer bezogen auf die Praxis des Lebens, zu der die Literatur die Theorie ist. Das ist nämlich einer der poetischen Grundsätze schlechthin, er wird von Juli Zeh einem ungenannten „guten Freund“ zugeschrieben, und er lautet, noch einmal zum Mitschreiben und an die Kühlschranktür hängen (notfalls auch an den Bildschirm): „Literatur ist die Theorie der Praxis“. Der Satz ist vertrackter als er klingt, aber er ist – wahrscheinlich wahr, soweit Sätze überhaupt wahr sein können. Die Praxis – des menschlichen Lebens, des Daseins auf dieser Welt – hat eine Theorie; aber sie ist in der Literatur zu finden, und nicht dort, wo man sie eigentlich suchen würde (in der Philosophie, der Psychologie, der Geschichte oder wo sonst der Mantel der Abstraktion weht).
Der Autor jedoch, die Schriftstellerin – schreibt. Das kann man lernen, zum Beispiel am Deutschen Literaturinstitut; auch wenn man dabei gelegentlich das Falsche lernt (Beispiele zuhauf im Text). Man macht sowieso jede Menge Fehler dabei, man produziert mehr für die Schublade als für die Druckerpresse (auch Treidel wird in der Schublade landen, nicht aber das Treidel-Prinzip). Man leidet dabei, weil Schreiben immer peinlich ist (Beweis aus der Selbsterfahrung) und fühlt sich die ganze Zeit wie ein Zauberer, dessen Tricks jeden Moment enthüllt werden können (dazu könnte man auch Thomas Mann zitieren, was Juli Zeh gern tut, und immer genau haarscharf auf der Grenze, dass man nicht weiß, ob es ein echtes oder ein falsches Zitat ist). Schreiben macht keinen Spaß; aber das Autorendasein zwischen Vortragsreise, schlechten Mittelklassehotels, unzuverlässigen Zügen, in denen man sich „Frustbeulen“ holt, und Interviewanfragen, Interviewanfragen, Interviewanfragen ist der Preis dafür, dass man – ein freier Mensch bleiben darf, in Grenzen. Und deshalb auch seine Meinung sagen darf, zu politischen Themen und überhaupt zu allem, wozu man eine begründete Meinung haben kann.
Das verdient ein längeres Zitat, weil es so un-selbstverständlich geworden ist: Der Autor „ist kein Berufspolitiker, kein Berufsjournalist, kein Berufskommunikator, kein Berufsexperte. Deshalb verfügt er auch nicht über spezielle Insider-Informationen oder besonderes Fachwissen. Er sitzt einfach da, strengt seinen Verstand an und schreibt einen Beitrag, sagen wir, über den Zustand der deutschen Medienbranche. Der Autor besitzt also den seltenen Fall einer unabhängigen Stimme. Er denkt und spricht als normaler Bürger. … Die Delegation von kritischem Bewusstsein an die Befugten der Expertokratie ist heutzutage wahrscheinlich die häufigste Form von selbstverschuldeter Unmündigkeit“. Aber, um dem verbreitetsten Missverständnis vorzubeugen, das Juli Zeh gern dem archetypischen Oberstufen-Lehrer im Deutsch-Leistungskurs eines deutschen Gymnasiums (wir vermuten ein gewisses Trauma und können es nachvollziehen) zuschreibt: Der Autor hat keine Botschaft in seinen literarischen Texten versteckt. Er will uns damit nicht „etwas sagen“. Wenn sie etwas sagen will, schreibt sie, notfalls, einen Essay, der dann immer noch missverstanden werden wird.
Warum dann aber Literatur? Das ist eine Frage, die jede Poetik, selbst wenn sie gleichzeitig eine Anti-Poetik ist, beantworten muss. Und damit kommen wir zurück zur Literatur als „Theorie der Praxis“. Denn Juli Zeh schlägt vor – und es ist eine plausible Annahme, die gerade in der Hochkonjunktur des „Narrativ“-Begriffs recht hübsch illustriert wird –, dass die Fähigkeit des Menschen, Geschichten zu erzählen, angeboren sei: „Vielleicht ist es dieser narrative Sinn, der den Menschen wahrhaft vom Tier unterscheidet, denn Sprache als bloßes Kommunikationsmittel kommt auch in der Tierwelt vor. Der Mensch aber trägt ein Muster in sich, nach dem er Geschichten baut.“ Alles Erzählen ist eine „Erinnerungstechnik“; es ist diejenige Technik, nach der wir uns den Sinn in unser Leben hineindenken: „Wenn wir nun wissen, dass narratives Erinnern der Herausbildung einer Biographie und damit der Entstehung unserer Persönlichkeit dient …, wenn wir also in aller Kürze sagen können: ‚Ich dichte, also bin ich‘ – dann ist Erzählen ein Trainingsprogramm in Sachen Menschwerdung und die Literatur ein Fitnesscenter, in dem wir unsere narrativen Erinnerungsmuskeln stählen, um zu möglichst kunstvoller Selbsterschaffung in der Lage zu sein“. Lügen die Dichter? Ach, wir alle lügen, immerzu, am meisten lügen wir, wenn wir ganz überzeugt sind, die Wahrheit zu sagen (wie der berüchtigte „Knallzeuge“ vor Gericht, aber das möge jede selbst nachlesen). Wir alle sind unsere eigenen Romanfiguren. Identität ist eine Fiktion. Aber wir brauchen sie, um leben zu können.
Das als Hoffnungs-Lichtlein zum Schluss. Ist es eines? Gibt es uns genug Licht und Kraft, um Weitertreideln zu können? Voltaire würde sagen, dass wir lieber unseren Garten umgraben sollten. Juli Zeh würde sagen, dass sie jetzt die Pferde füttern muss. Die Autorin sagt – dass der Blog jetzt aus ist und ein Abendessen gekocht werden muss!
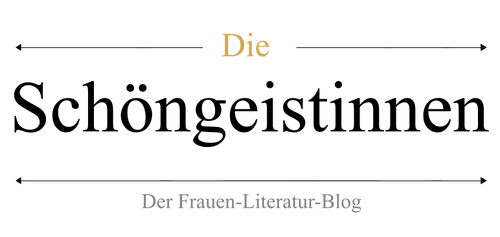

Comments: no replies