Zu Richard Powers Roman ‚Playground‘
Mit dem Spielen ist es eine ernste Sache. Das ganze Leben ist ein Spiel, so lautet ein bekannter Spruch; und sogar die Ergänzung Und wir sind nur die Kandidaten aus der Pop-Kultur hat eine ziemlich tiefe Weisheit. Und Schiller gar, als er einen seiner bekannten Sätze schrieb: „der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ – er wusste ja nicht, er konnte ja noch nicht wissen, wie recht er damit hatte! Denn das ganze Leben ist ein Spiel, das ist ein Grundsatz der Evolution, die erfindet ohne Ende und Sinn und Zweck, nur damit das Leben weitergeht, spielerisch, von einer Erfindung zur nächsten. Und wer das nicht glaubt, gehe in den nächsten Zoo oder in der Karibik schnorcheln oder – lese den neuesten Roman von Richard Powers: Playground heißt er, und er zeigt – genau. Nein, man muss noch etwas dazu sagen: Er zeigt nicht nur, dass das ganze Leben ein Spiel ist, sondern: Er nimmt den Satz so wörtlich, wie man ihn nur nehmen kann. Das ganze Leben ist ein Spiel, es ist nicht irgendwie wie ein Spiel oder einem Spiel in gewisser Weise ähnlich; es ist in seinem tiefsten Grund – sei es der des tiefsten Meeres oder der des tiefsten, profundesten (es hat einen Grund, dieses etwas preziöse Wort hier zu verwenden) Geistes, Spiel durch und durch. Denn am Anfang –
– und mit einem Schöpfungsmythos beginnt das grandiose Buch. Alle Bücher von Richard Powers sind grandiose Bücher, sie quellen über von Wissen und Intelligenz und Kenntnissen und grandiosen Ideen und grandiosen Figuren. Das muss man mögen, und man muss es mindestens zweimal lesen, weil man beim ersten Mal einfach überfordert ist. Dieses grandiose Buch namens Playground also – und ja, natürlich ist der Roman selbst ein Spielplatz, ein Ideen-Spielplatz wie ein Lebens-Spielplatz – beginnt wie alle grandiosen Bücher also ganz am Anfang, ab ovo pro, wie die Kennerin sagt. Was nun schon wieder wörtlich zu nehmen ist. Denn ganz am Anfang wird ein polynesischer Schöpfungsmythos zitiert. Er kreist um Ta’araoa, und Ta’aora ist ganz allein. Er hat sich selbst geschaffen, den Anfang von allem (und damit gleichzeitig die Zeit); und dann hat er sich ein Ei geschaffen, damit er etwas hat, worin er wohnen kann, und dann – vergeht die eine oder andere kleine Ewigkeit, Ta‘araoa dreht sich in seinem Ei um sich selbst, und irgendwann langweilt er sich. Deshalb zerbricht er sein Ei – und müssen wir das nicht alle, irgendwann in unserer Entwicklung als Lebewesen, phylo- und ontogenetisch wie symbolisch? –, und dann nimmt er die Schalen und dann weint er ein Stück und dann macht er aus dem, was diese ersten Stoffe hergeben – eine Welt. Das Außergewöhnliche an diesem speziellen Schöpfungsmythos ist nun, dass Ta’aroa nur eine Elementarwelt erschafft aus diesen Elementarstoffen. Für alles weitere aber ruft er die Künstler herbei (und natürlich fragt die Rationalistin in uns, wo denn bitte zu diesem Zeitpunkt Künstler herkommen, die hat er doch noch gar nicht geschaffen? – egal, es geht ums Prinzip), und die Künstler schaffen die anderen Götter und den ganzen Rest. Und am Ende, die Welt hat inzwischen sieben Schichten oder Schalen bekommen, erschafft Ta’aroa schließlich persönlich den Menschen, sich zur Lust und zum Spiel; ein Wesen nämlich, dass nun in seiner untersten Schale damit beginnt, eigene Welten zu schaffen, und dabei zerbricht es die Schale, um zur nächsten vorzudringen, und immer weiter, immer weiter, das ist der menschliche Imperativ (Of all the things we human excel at, moving the goalposts may be our best trick. The moment advanced AIs get good at that, they’ll pass the real Turing Test), bis zur letzten Schale, und dann –
Aber selbst dann, als der Mensch die letzte Schale durchbrochen hat und wie auf alten Kupferstichen vom Sonnensystems jetzt seinen Kopf durch die letzte Himmelssphäre nach außen streckt – selbst dann ist immer noch alles bei Ta‘araoa, es gehört ihm, dem Herrn und Schöpfer von allem. Dasjenige Wesen, das der Mensch jedoch schafft, als er die letzte seiner Sphären zerbrochen hat, ist, natürlich: eine AI. Es ist nicht irgendeine AI, sondern eine im Evolutionsprozess der künstlichen Intelligenz schon ziemlich weit fortgeschrittene AI, mit einer eigenen Ahnengeschichte. Sie heißt, ein kleiner Tusch bitte: Profunda, die Tiefgründige; und sie kann Geschichten erzählen, dass ihrem Erfinder, dem Abbild Ta‘araoas im Text, dem Vor-Erzähler der letzten menschlichen Stufe – der Atem stockt. Playground ist die Geschichte, wie sie die AI erzählt; sie ist nicht die wahre Geschichte. Aber was ist die wahre Geschichte?
Das herauszufinden ist, um das mindeste zu sagen: kompliziert; vielleicht ist es unmöglich. Selbst nach der Zweitlektüre muss man sich die Handlungsfäden mühsam zurechtlegen, und es sind wie immer bei Richard Powers so viele, dass man einige wieder beiseitelegen muss, so verführerisch sie auch glänzen. Zum Beispiel die Geschichte der uralten Meeresbiologin, die, seit das Tauchen sie als Kind zum Leben errettete, die Meere retten will und all die intelligenten, vielfältigen, bizarr geformten, tanzenden und spielenden Wesen in ihnen, zuvörderst: die großen Manta Rays, eine Art von großer Intelligenz und noch größerer spielerischer Eleganz. Oder die Geschichte der Insel Makatoa, einem Solitär in Französisch-Polynesien und mehr dem Meer als dem Land zugehörig, samt der Geschichten seiner 82 Bewohner, ein Abbild der Menschheit in all ihren Extremen und Mittelwegen. Aber im Zentrum des Romans stehen zwei Männer, jeder höchstbegabt; der eine weiß und überprivilegiert im Extrem, der andere schwarz und aus allerschwierigsten Familienverhältnissen. Der eine wird Milliardär und erobert mit seinem selbst entworfenen digitalen Playground die Welt. Der andere bleibt ein Poet und Büchernarr und stirbt als Einsiedler. In der „realen“ Geschichte jedenfalls; nicht aber in der, die Profunda uns erzählen wird und wo er ewig weiterlebt. Die beiden spielen, seit sie sich in ihrer Jugend gefunden und in ihren archaischen Kontrasten als komplementäre Hälften erkannt haben; sie spielen zuerst Schach, sie spielen danach Go, sie spielen jedes Strategiespiel der Welt, und sie spielen: umeinander, um die Anerkennung, um die Liebe des Anderen, und darüber hinaus und damit verbunden: um die Weltherrschaft des Digitalen oder des Analogen, der Intelligenz oder der Poesie. Zwischen ihnen aber steht – das war zu erwarten, immerhin sind wir in einem Roman – natürlich eine Frau: die Dritte, die Inselbewohnerin aus dem Pazifik, die die ganze Welt als Kunstwerk sieht und Kunstwerke schafft, in denen alles seinen Platz findet, Schicht um Schicht – bevor sie dann vergehen, zerstört werden, überwachsen und überwuchert von anderen Schichten des Lebendigen. Als geborene Künstlerin ist Ina die größte Spielerin von allen; und dass sie ihr letztes Kunstwerk im Roman aus menschlichen Müll anfertigt, der am perfekten Inselstrand angespült wird; und dass dieses letzte Kunstwerk am Ende –
Aber das wäre zu viel verraten. Nein, wir kommen lieber wieder zurück zur Ausgangsfrage des Spiels, nämlich: Wenn alles im Leben ein Spiel ist; wenn das Leben selbst das größte Spiel von allen ist, das die Evolution nicht nur mit dem Menschen, sondern die ganze Schöpfung mit sich selbst spielt; und wenn die AI nur die neueste Schicht in diesem Spiel des Lebendigen ist, das sich beständig aus sich selbst hervorbringt – was ist dann der Sinn des Ganzen? Ein Mittel gegen die Langeweile, sicherlich; so wie Ta‘araoa sich eine Welt erschuf, damit die ewige Langeweile ein Ende hatte, erschafft sich der Romanautor eine Welt und taucht der Leser – schöne Metapher, gerade in diesem taucherverliebten Buch! – in die so geschaffene Welt ein. Etwas trivial, aber wahr. Die Evolution ist ein Zaubermittel gegen die Langeweile, und – das ist ein echtes Anliegen des Buches! – das Meer ihr eigentlicher Spielplatz, in dem Menschen: nichts zu sagen haben.
Fragen wir aber noch weiter: Was ist der Sinn dieses universalen Spiels? Ein Durchbrechen von Schalen, ein Vorstoß in immer neue Sphären, ein ewiges Weiterrücken des goalpost? Das wäre die heroischere Lesart. Und sie impliziert: Im Schaffen werden Dinge zerstört und entstehen neue; und die menschliche Unterscheidung zwischen intelligenten und einsichtslosen Agenten, zwischen bewussten und nicht-bewussten Seinsformen, ja gar: zwischen belebten und unbelebten Wesen mag sich dabei als ziemlich künstlich und naiv-anthropozentrisch herausstellen. Das wird wehtun, dem menschlichen Selbstbewusstsein vor allem, das sich immer mit einer Krone denken muss; aber es ist denk-notwendig (I won’t live to see the blow you’ll inflict on human thought, the damage you’ll do to our self-image, the mayhem you and your offspring will wage on human culture, the power you’ll scatter. I can’t begin to imagine what further creatures you’ll give birth to). Denn Schöpfung kann aus allem geschehen. Und jeder, der nur einen winzigen Schöpfungsakt vollzieht und dabei eine Spur weit aus dem Ei schlüpft, ist ein Künstler; egal, was er produziert, und völlig egal, wie gut oder schlecht er oder sie oder es das tun. Ob sie etwas damit sagen wollen oder auch nur etwas zeigen; ob sie überhaupt etwas damit wollen: egal. Man spielt ja nicht, weil man damit etwas sagen oder zeigen oder überhaupt etwas will; man spielt, weil man spielen will.
Beim Spielen jedoch, solange es halbwegs ernsthaft passiert: Lernt man etwas. Das ist geradezu unvermeidlich. Deshalb, so eine der steileren Thesen des Richard Powers in diesem Roman, ist Spielen derjenige evolutionäre Prozess, durch den Lernen stattfindet; immer und überall, nicht nur beim Menschen (Play was evolution’s way of building brains, and any creature with a brain as developed as a giant oceanic manta sure used it. If you want to make something smarter, teach it to play.) Denn was tut man beim Spielen? Wir denken an unser erstes, kindliches Mensch-ärgere-dich-nicht; wir denken an die größten Schachspiele der Geschichte; wir denken an WoW oder Minecraft oder Monopoly. Egal. Das, worauf es in jedem Spiel ankommt, ist immer: der nächste Zug. Genauso wie bei der Evolution, der genialen Erfindung der ewigen Fortschreibung der Schöpfung durch Fehler und Selbstkorrektur. Genauso wie im Romanschreiben: Das worauf es ankommt, ist immer das nächste Worte. Der nächste Satz. Genauso – und das ist ein wunderbar genialer Schlüsselsatz des Romans – wie eine profunde AI, die einen Roman schreibt, der das Leben nicht einfach abbildet, sondern in gewisser Hinsicht übertrifft. Aber sie tut eigentlich nichts anderes, als immer – das wahrscheinlich nächste Worte zu finden (was wiederum wörtlich und in einem technischen Sinne wahr ist und gleichzeitig symbolisch und profund): The author of all this richness does nothing but to find the next most likely word.
Auf Deutsch erschienen unter dem Titel: „Das große Spiel“ (übersetzt von Eva Bonné)
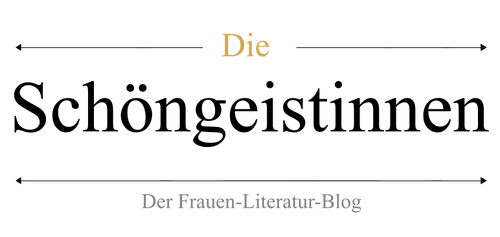

Comments: no replies