Zuerst meint man, es gehe um die Romantik, also: die historische und speziell deutsche Romantik als Epoche, mit ihrer Vorliebe für das Unerreichbare, die ewige Sehnsucht, die niemals zu findende blaue Blume, und in letzter Konsequenz: den Tod. Und es spricht ja auch einiges dafür: Zwei historische Selbstmörder besprechen sich, in Winkel, so heißt der Ort am Rhein wirklich. Aber es ist auch ein metaphysischer Winkel, ein Zwischenraum, in dem sich zwei Lebens- und Seelenverwandte finden, ein Mann und eine Frau, und sie sind verschieden und sie sind sich ähnlich, und sie können nicht leben in dem Leben, das ihnen vom Schicksal und ihrer Herkunft zugeteilt wurde, aber sie können auch nicht leben in dem Leben, das sie sich erträumen: Kein Ort, Nirgends. So heißt die Erzählung von Christa Wolf aus dem Jahr 1979, und der Titel ist eine Umschreibung des Wort und Konzeptes „Utopie“. Aber muss diese spezielle Utopie denn wirklich eine romantische Idee sein, oder: gibt es hier etwas wie eine – sagen wir: realistisch unterfütterte Utopie, einen realen Nicht-Ort (und ich meine nicht: in der Literatur, dem klassischen Fluchtort für Lebensunwillige und Lebensunfähige)?
Die (historisch realen) Gesprächspartner in Kein Ort. Nirgends sind Karoline von Günderrode, Autorin eines soeben erschienen Gedichtbandes unter dem Pseudonym „Tian“. Alle Welt war erstaunt über die lyrische Perfektion der unbekannten Autorin, sogar Goethe lobte ein wenig, und ihr Freund (und Möchtegern-Liebhaber) Clemens Brentano war ein wenig gekränkt darüber, dass man ihm diese Perfektion vorenthalten hatte. Aber sie ist auch: Stiftsfräulein, das war die einzig halbwegs lebbare Alternative zur ungewollten Ehe, der Unterordnung unter einen Mann; und ihre Liebesverhältnisse waren (man kann vermuten: mit einer gewissen Absicht) genauso unlebbar wie ihre ganzes Leben (verheiratete Männer, eindrucksvolle Persönlichkeiten, zweifellos, aber auch: ihrer nicht ganz würdig). Und Karoline trägt im Gespräch den Dolch schon bei sich, den sie sich mit Kraft ins Herz stechen wird, dort, wo der Arzt ihr im Scherz die Stelle gezeigt hatte.
Ihr Gesprächspartner ist Heinrich von Kleist, ein inzwischen schon in der Welt herumgekommener Lebensflüchtling (von Preußen nach Paris und wieder zurück, mit einem Zwischenstop als Bauer in der Schweiz), derzeit in ärztlicher Obhut und – nun ja, immer eine Minute vor der endgültigen Explosion, eine menschliche Zeitbombe. Kleist schreibt im übrigen Prosa, ausschließlich; aber mit der gleichen scharfen Präzision und Perfektion bis ins letzte Komma, wie Günderrode ihre Lyrik schreibt. Und beide sind, sowieso: Denkende, die sich mit der zeitgenössischen Philosophie beschäftigen; er ist an Kant gescheitert, der ihm seinen Lebensplan zerstört hat, sie steigert sich in die idealistische Philosophie, die ihre Unlebbarkeit in gewisser Weise legitimiert. Leben allerdings –
findet immer nur momentweise statt, beispielsweise hier im Winkel. Man geht am Rhein entlang und sieht wirkliche Menschen bei wirklichen Tätigkeiten und imaginiert sich ein wenig, wie es wäre, wenn man ein Handwerk gelernt hätte und es nun ausüben könnte, wirkliche Dinge machen und sich ab und zu auf mit dem Hammer auf den Daumen hauen und wirkliches Blut vergießen. Noch jeder Dichter von einiger menschlicher Größe hatte diese Phantasie, irgendwann. Aber dann arbeiten die beiden Schreibenden doch wieder daran, ihre Dichtung wirklich zu machen. Und da das Leben nun einmal unlebbar ist, heißt das: Ihre Dichtung hat noch keine Sprache (denn wo wäre sie zu finden gewesen im unlebbaren Leben?), sie ist erst zu finden. Und wenn man sie findet, führt sie vielleicht in den Tod, den frei gewählten, und das hat man zu wissen, und das ist keine Flucht und kein Versagen, sondern Konsequenz und Freiheit.
Am wirklichsten in Bezug auf das Leben jedoch wird der Text, wenn er von Frauen und Männern spricht. Und es ist an diesem Punkt, ziemlich spät im Gespräch der beiden, als Karoline auf einmal deutlich realistischer wird und ausnahmsweise beinahe zu einem kleinen Vortrag ausholt (sonst spricht man eher in ein wenig rätselhaften Maximen). Er geht so: „Sie sagt, nach ihrer Beobachtung gehöre zum Leben der Frauen mehr Mut als zu dem der Männer. Wenn sie von einer Frau höre, die diesen Mut aufbringe, verlange es sie danach, mit ihr bekannt zu sein. Es sei nämlich dahin gekommen, daß die Frauen, auch über Entfernungen hinweg, einander stützen müßten, da die Männer nicht mehr dazu imstande sein. … Weil die Männer, die für uns in Frage kämen, selbst in auswegloser Verstrickung sind. Ihr werdet durch den Gang der Geschäfte, die euch obliegen, in Stücke zerteilt, die kaum miteinander zusammenhängen. Wir sind auf den ganzen Menschen aus und können ihn nicht finden.“ Ja, den „ganzen Menschen“, das ist eine Plattitüde und gleichzeitig eine Zauberformel des späten 18. Jahrhunderts; aber man hat kein besseres Wort für diesen (noch?) undenkbaren Gedanken, und die darauf aufbauende Diagnose der persönlichkeitszerspaltenden, den ganzen Menschen in Stücke zerreißenden Wirkung von Berufstätigkeit und Arbeitsteilung ist frisch bis auf den Moment.
Doch auch die Frauen, die gerade durch ihr reales Berufsverbot vor dieser Zerteilung in Stücke geschützt sein könnten, leben nicht in der besten aller möglichen Welten: „man verbietet uns früh, unglücklich zu sein über unsere eingebildeten Leiden. Siebzehnjährig müssen wir einverstanden mit unserm Schicksal, das der Mann ist, und müssen für den unwahrscheinlichen Fall von Widersetzlichkeit die Strafe kennen und sie angenommen haben. Wie oft ich ein Mann sein wollte, mich sehnte nach den wirklichen Verletzungen, die ihr euch zuzieht!“ Sagt Karoline. Wirkliche Verletzungen, nicht eingebildete Leiden: Das ist ein seltsames Verlangen, aber es ist herzzerreißend wahr. Denn im „Reich der Ideen“, das man den Frauen zugeteilt hat – so Kleist in einem kleinen Anfall von Neid und Wunschdenken –, gibt es nur (und nun spricht wieder die Günderrode): „Ideen, die folgenlos bleiben. So wirken auch wir mit an der Aufteilung der Menschen in Tätige und Denkende. Merken wir nicht, wie die Taten derer, die das Handeln an sich reißen, immer unbedenklicher werden? Wie die Poesie der Tatenlosen den Zwecken der Handelnden immer mehr entspricht? Müssen wir, die wir uns in keine praktische Tätigkeit schicken können, nicht fürchten, zum weibischen Geschlecht der Lamentierenden zu werden, unfähig zu dem kleinsten Zugeständnis, das die alltäglichen Geschäfte einem jeden abverlangen, und verrannt in einen Anspruch, den auf Erden keiner je erfüllen kann: Tätig zu werden und dabei wir selbst zu bleiben?“ Das ist der Satz, der den Idealismus auf die Erde zurückholt: Wer immer tätig wird, verändert sich. Notwendig. Egal, ob zum Besseren oder zum Schlechteren. Taten haben Konsequenzen. Im „Reich der Ideen“ mag man lamentieren, befreit von jeglicher Verantwortung für jedwede Folgen, und das dafür verwendete Wort aus dem Mund der Frau ist hart: Es ist „weibisch“. Schwach und blutleer und voller Ressentiment. Derweil wird das Handeln der Handelnden immer „unbedenklicher“ – ihre Taten sind nicht durchdacht auf ihre (wirklichen, blutigen) Konsequenzen hin, und sie sind auch nicht zu denken. Derweil wird die „Poesie der Tatenlosen“ – entweder weibisches Lamentieren oder Propaganda. Wo ist der Zwischenraum?
Aber nein, so weit ist es nicht gekommen mit Christa Wolf, obwohl einige ihr das vorwerfen wollten. Kein Ort, nirgends – doch es gibt eine Art innere und äußere Emigration. Nicht nur in die Romantik, sondern auch und vor allem in die Antike (Kassandra und Medea. Stimmen). Ins Gespräch, das wirkliche, in dem Ähnlichkeit und Unterschied stattfindet. Ins Tagebuch, den unbestechlichen Lebensspiegel des (erzählbaren? unerzählbaren?) Alltags. „Wann, wenn nicht jetzt?“ Das ist der Satz, den ich mir als erstes von Christa Wolf notiert habe, er ist aus ihrem großen Roman Nachdenken über Christa T., und ich war wahrscheinlich noch spätpubertär, als ich ihn las und er mich ansprang, so wie einige Sätze einen anspringen, als seien sie schon aus einer anderen Sprache. Aber es ist ein Satz, den man sich jederzeit notieren kann, gleich neben: Kein Ort, nirgends. Und trotzdem: Wann, wenn nicht jetzt? Beides zusammen erst macht den ganzen Sinn.
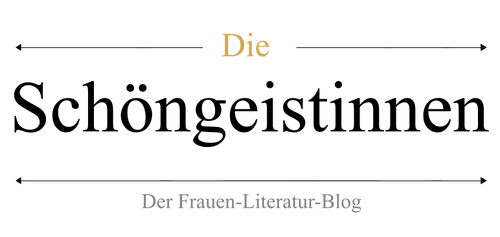

Comments: no replies