Das Floß der Medusa: Schiffbruch als Menschheitsmetapher
Es ist ein Bild, das Kultur- und Geistesgeschichte, ja sogar Realgeschichte geschrieben hat, und das nicht seiner augenschmeichelnden Schönheit wegen; ganz im Gegenteil. Es heißt Das Floß der Medusa, gemalt hat es ein junger, ehrgeiziger Maler namens Théodore Géricault, der damit berühmt werden wollte – was ihm gelungen ist, das monumentale Werk (5 x 7 Meter ungefähr) sorgte bei seiner Ausstellung beim Pariser Salon 1819 für viel Wirbel. Auch bei der darauffolgenden Präsentation in London war es ein großer Erfolg, aber Géricault hatte nicht mehr viel davon; gesundheitlich geschwächt durch Tuberkulose starb er 1824 bei einem Reitunfall (vor dem Floß war er vor allem als Pferdemaler bekannt gewesen).

Zu dem Erfolg des Bildes trugen nicht nur die neuartige Kombination von hyperrealistischer Malweise, virtuoser klassischer Dreiecks-Komposition und ästhetischer Meisterschaft in der Anordnung von muskulösen männlichen Körpern bei, die Géricault in Florenz bei Michelangelo studiert hatte. Die bildkünstlerische Meisterleistung in farblicher Morbidität griff vielmehr einen aktuellen Skandal auf, der gerade zu einem Symbol der Korruption der Herrschaftselite stilisiert worden war: Die voll besetzte französische Fregatte Méduse nämlich war auf dem Weg in den Senegal, als sie vor Mauretanien, wohl nautischer Unerfahrenheit des Führungspersonals wegen, auf Grund lief. Die sechs Rettungsboote reichten bei weitem nicht für die gesamte Besatzung, und so ordnete der Kapitän den Bau eines riesigen Rettungsfloßes aus den Masten der Méduse an. Von da an verliert sich die Geschichte in den Versionen der wenigen Überlebenden; kolportiert wurde, dass es bei denjenigen, die es auf das Floß geschafft hatten, nach einigen Tagen ohne Proviant und Trinkwasser unter der gleißenden Sonne Afrikas Kannibalismus gegeben hatte, bis sie endlich ein Schiff aufspürte, das passenderweise Argus hieß.
Man möchte sich diese Geschichte wirklich nicht in den Details ausmalen, aber genau das tat Theodore Géricault. Nicht nur sprach er ausführlich mit den Überlebenden und fertigte Notizen dazu; beriet sich mit Ingenieuren und baute Modelle eines Floßes; nein, er ließ sich sogar Leichenteile von Amputierten ins Studio bringen und fertigte Zeichnungen von ihnen an (einmal bekam er auch einen abgeschlagenen Kopf. Seien wir froh, dass er es nicht auf das Bild geschafft hat, obwohl abgeschlagene Köpfe im Folgenden eine Rolle spielen werden). Wie besessen soll er gewesen sein, von dem Thema, von seinen morbiden Studien, von seinem Meisterwerk; monatelang schloss er sich in seinem Atelier ein, lebte wie ein Mönch und schor sich den Kopf. Spürt man das in den Figuren auf dem Floß, der Pyramide aus lebenden und toten Körpern, die sich ineinander verschlingen in einer Mischung aus Agonie und letzter, verzweifelter Hoffnung? Géricault hat sie nach lebenden Modellen gearbeitet, darunter seinen Malerfreund Délacroix; dazu studierte er die düsteren Klassiker der Kriegs- und Katastrophenmalerei, wie Goya oder Henri Fuseli. Offensichtlich hatte sich Géricault auf einen dunklen Pfad begeben. Dass er danach nicht mehr zur Pferdemalerei zurückkehren konnte, war offensichtlich; dass er bei einem Reitunfall umkam, eine herzlose Ironie der Geschichte.
Das Floß der Medusa – wie passend erschien im Nachhinein die Namensgebung der Fregatte, mit der man dem Kriegsschiff wohl nur einen harmlosen Anschein literarischer Bildung verleihen wollte! Wenig wussten sie bei der Einweihung, dass jeder auf dem Floß (es war wohl nur eine Frau an Bord der Fregatte gewesen, und sie war nicht unter den Überlebenden) einer Realität ins Auge blicken sollte, die schlimmer war als der sagenhafte Kopf der antiken Gottheit mit den Schlangenhaaren und dem starren Blick! Das Floß der Medusa, die Geschichte und das Gemälde zusammen: Schnell wurden sie eine Art kulturpessimistischer Menschheitsmetapher, die bizarrerweise bis heute tragfähig ist. Denn sind wir nicht alle gefangen auf einem immer stärker ins Schwanken geratenden Floß in einem riesigen Universum bei schwindenden Ressourcen; und wer wird am Ende überleben, und zu welchem Preis? Wie lange hält der zivilisatorische Anstrich, und wann wird der Mensch dem Menschen im wörtlichsten Sinne zur Bestie? Und eines ist sicher: Wir werden nicht in der Schönheit sterben, die Géricault noch seinen Leichen zu geben wusste!
Medusa: Schönheit und Schlangen, untrennbar verschlungen
Wer aber war Medusa, die einzige Frau in dieser düsteren Geschichte, wenn sie zuhause war? Vielleicht taucht bei der einen oder anderen jetzt der Schlangenkopf als Bild auf, er ziert beispielsweise auch sehr ins Dekorative gezähmt eine Parfumflasche. Aber das ist natürlich nur unser aller Viertelwissen. Andererseits: Was in den griechischen und römischen Mythen ursprünglich von ihr überliefert ist, was die Künstler, Literaten und Philosophen aller Zeiten aus ihr gemacht haben, welche Fetzen sie an sich gerissen und ihre Flösse damit verstärkt haben – es ist ein wahrer Schlangenkopf an Deutung und Missdeutung, bei dessen genauerer Betrachtung man (na gut, eher: frau) gerne erstarren würde! Hier die Geschichte dazu, so wie sie sich aus den unterschiedlichsten Quellen zusammengetragen darstellt, samt beliebiger und beliebter Nutzanwendung:
Medusa war, wahlweise, als eine der drei Gorgonen von Geburt her so grottenhässlich (und, aus dramaturgischen Gründen als einzige von ihnen sterblich; sonst funktioniert nämlich die weitere Geschichte nicht), dass man sie nicht anschauen konnte. Oder sie war so schön, und zwar vor allem: schönhaarig, dass der Gott Poseidon, einer der unzähligen Verehrer ihrer lockenreichen Pracht, sie im Tempel der Athene vergewaltigte. Was Athene zufällig entdeckte und in ihrer Wut auf das unzüchtige Treiben an heiliger Stelle – das Opfer bestrafte, indem sie die Locken in züngelnde Schlangen wandelte, und fortan konnte die vormals schöne Medusa keiner mehr ansehen, ohne zu Stein zu erstarren (die Lehre daraus ist offensichtlich: Schaut der hässlichen Wirklichkeit besser niemals direkt und untgeschützt ins Auge!) Allerdings kann man der hässlichen Wirklichkeit im Spiegel ins Auge schauen; das nämlich verriet Athene dem Helden Perseus, der im Rahmen einer absurden männlichen Mutprobe unterwegs war, um die Gorgone zu köpfen (in der Reflexion ist die hässliche Wirklichkeit erträglich?) Perseus köpfte unter Einsatz von unfairen Hilfsmitteln Medusa und galt fortan als Held (wenn man gewonnen ist, ist man automatisch der Held, die Nachwelt interessiert sich nur für Ergebnisse!). Medusa war im Übrigen schwanger gewesen zu diesem Zeitpunkt, siehe oben; und ihrem toten Leib entsprang das Ross Pegasus, das später als Dichterross zu internationaler Berühmtheit galoppieren sollte (Dichtung entspringt aus Gewaltakten – an der Wirklichkeit, an den Frauen, es macht keinen Unterschied?). Der Held Perseus trägt fortan den abgeschlagenen Schlangenkopf im Kampf bei sich, und die Gegner fallen reihenweise um; bis ihn Athene dann endgültig übernimmt und ihrem Brustpanzer einverleibt (nein, wir hören jetzt auf mit den kommentieren Lehren, das kann sichjede selbst zusammenreimen). Ach so, vorher hat Athene übrigens noch Medusens Blut an Asklepios verschenkt, den späteren Gott der Heilkunst. Und wie dann noch Freud (Kastrationsangst, männliche) und der Feminismus über sie hergefallen sind und sich die letzten Trümmer auf ihr eigenes Floß geholt haben (female fury! in a good sense, obviously) – die arme Medusa, viel mehr Kleinholz geht nicht!
Worauf es jedoch ankäme, wäre: Medusa ins Gesicht zu schauen, und nicht in den Spiegel – der Reflexion, der Geschichte, des Mythos. Und vielleicht könnte man dann erleben, dass Medusa – zurückschaut; und jeder Schlangenkopf lächelt.

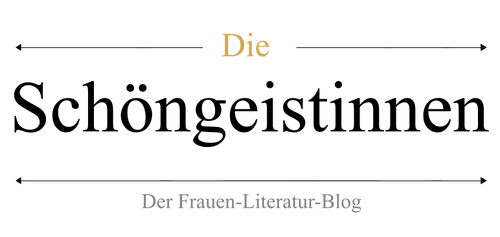

Comments: no replies