Sie selbst schätzte, so schrieb sie spät in ihrem Leben an den Frauenmagazin-Herausgeber Friedrich Rochlitz, ihre „glückliche Verborgenheit“; sie sei ein „Schleier, der sie vor Lob und Tadel schütze“. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits über fünfzig Roman, Erzählungen und Märchensammlungen veröffentlicht; alle anonym, und die Öffentlichkeit hatte gerätselt, und Autoritäten hatten befunden, es müsse sich um „einen Mann und um keinen mittelmäßigen Kopf“ (Körner an Schiller) handeln. Als ihr Inkognito 1817 gegen ihren Willen in einem Zeitschriftenaufsatz gelüftet wird, schreibt sie unwillig, sie werde „das Weyrauchfaß“, das man ihr „so unbarmherzig an den Kopf geworfen wurde“, wohl „noch eine Weile fühlen“. Zwei Jahre später starb sie, erblindet. Ihre letzten Romane hatte sie einer Verwandten diktiert und endlich auch mit ihrem eigenen Namen gezeichnet: Benedikte Naubert.
Das hört sich an wie das allbekannte Schicksal schreibender Frauen bis vor sehr kurzer Zeit; und man kann und hat das beklagt, aber manchmal sollte man auch auf die Betroffenen selbst hören. So tendieren die meist feministisch inspirierten Literaturwissenschafterinnen, die Naubert schon vor einiger Zeit wiederentdeckt haben, dazu, das anfangs zitierte Wort vom Glück der Verborgenheit nicht ernstzunehmen; nein, da versteckte sich nur wieder eine ernstzunehmende, erfolgreiche und viel gelesene Autorin aus falsch verstandener Bescheidenheit und antrainierter weiblicher Demut hinter einem Vorurteil der Männer! Ach, ich bin mir gar nicht so sicher. Als schreibende Person hat man so seine Erfahrungen mit öffentlichem Lob wie Tadel (und es geht um beides, nicht nur um den Tadel). Und gerade in Zeiten, wo man leicht in das Kreuzfeuer von Meinungs- und ÜberzeungsfanatikerInnen von allen Seiten gerät, zumal im Freigelände des großen weiten Internet, ist eine „glückliche Verborgenheit“ nicht zu verachten. Denn vielleicht schreibt man ja – weil man schreiben will. Oder sogar muss. Damit ein Buch da ist, eine Geschichte mehr, etwas, was andere Leute lächeln oder nachdenken macht beim Lesen. Ist es dafür denn wirklich so wichtig, welcher Name auf dem Titelblatt steht?
Aber das mag meine eigene falsche weibliche Bescheidenheit sein. Das wirklich interessante am Fall Benedikte Neubert aber ist: Sie hat die Literaturgeschichte um eine eigene Gattung bereichert, und nicht um eine kleine oder nebensächliche oder nischenhafte, nein: Benedikte Naubert hat den historischen Roman erfunden! Das wusste ich bis gestern auch nicht (und ich bin eine Literaturwissenschaftlerin und habe mich gar nicht so wenig mit schreibenden Frauen beschäftigt). Denn als dessen Erfinder gilt gemeinhin der große, berühmte, weltweit angesehene und für seine Verdienste geadelte Schotte Sir Walter Scott. Goethe verehrte ihn (Scott übersetzte in seiner Jugend Goethes Götz von Berlichingen), und Fontane nannte ihn den „Shakespeare der Erzählung“. Seine mehrbändigen, umfangreichen Romane spielten in der schottischen Geschichte, vom Mittelalter bis kurz vor seiner Zeit; und sie sind Klassiker geworden, die bis heute gern verfilmt werden; und die Touristen strömen ehrfurchtsvoll durch seinen recht luxuriösen Wohnsitz, Abbotsford House bei Melrose.
Aber erfunden – erfunden hat den historischen Roman eine deutsche Frau, nämlich: Benedikte Naubert. Und das ist nicht nur irgendwie eine Behauptung, sondern einigermaßen belegt. Aber bleiben wir erst einmal bei Frau Naubert und versuchen, den Schleier ihrer „glücklichen Verborgenheit“ ein wenig zu lüften: Wer war sie, und wie kam sie dazu, den historischen Roman zu erfinden und anschließend komplett vergessen zu werden? Nun, sie war, wie mehrere der – wenigen – schreibenden Frauen des späten 18. Jahrhunderts eine Professorentochter. Geboren wurde sie im Jahr 1752 als Christiane Benedicta Hebenstreit; ihr Vater war der bei den Zeitgenossen durchaus berühmte Mediziner Johann Ernst Hebenstreit, der von August dem Starken als Leiter einer Expedition von 1731 bis 1733 nach Afrika reiste (er sollte möglichst viel Tiere und Pflanzen für das Kuriositätenkabinett des sammelwütigen Fürsten erwerben). Danach wurde Hebenstreit häuslich und ließ sich in Leipzig nieder, wo er in Erfüllung seiner beruflichen Pflichten 1757 an einer Typhus-Erkrankung verstarb; da war seine Tochter gerade ein Jahr alt. Ihre Mutter unterrichtete sie treu und brav, so kann man es in der Allgemeinen Deutschen Biographie lesen, in allen damals üblichen weiblichen Arbeiten; und Christiane Benedicta exzellierte „vorzüglich im Sticken, worin sie es zu einer solchen Geschicklichkeit brachte, daß sie ganze Gegenden mit leichter Mühe mit der Nadel aufnahm“. Wie auch immer man sich das genau vorstellen mag – das begabte Kind hatte zum Glück noch einige andere Talente, und ebenso noch andere Erzieher: Denn ihr Stiefbruder war Theologieprofessor, und er unterrichtete seine Halbschwester in Philosophie, Geschichte und den klassischen Sprachen, also Griechisch und Latein – was eine solide Basis für ihre späteren Geschichtsromane legte und ihr den Zugang zu den Originalquellen ermöglichte. Aus eigener Initiative soll sie außerdem die französische, englische und italienische Sprache erlernt haben (was nicht ganz unüblich war damals, jedenfalls für die männliche Jugend; Goethes Sprachkenntnisse als Jugendlicher waren ähnlich breit). Dazu spielte sie Klavier und Harfe, letzteres sogar wohl noch bis ins hohe Alter. Und als ihre Mutter erkrankte, soll sie sie hingebungsvoll gepflegt haben und die Hauswirtschaft versehen. Aber unter dem Schleier – da regte es sich wohl schon!
Denn 1779 erschien ihr erster Roman, anonym, da war sie 27 Jahre alt: Herfort und Klärchen. Etwas für empfindsame Seelen. Nun, das war ganz der Zeitmode der Empfindsamkeit verpflichtet und versprach im Untertitel sehr direkt Lesefutter. Doch schon das nächste Werk tritt massiver auf: Geschichte Emma’s, Tochter Kayser Karls des Grossen und Gattin seines Geheimschreibers Eginhards (2 Bände); und danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Viele von Nauberts Romanen spielen im Mittelalter, andere im 30jährigen Krieg; häufig sind Frauen die Haupt- und Titelfiguren. Wie wäre es mit: Barbara Blomberg, vorgebliche Mätresse Kaiser Karls des Fünften. Eine Originalgeschichte? Oder doch lieber: Elisabeth, Erbinn von Toggenburg oder Geschichte der Frauen von Sarganzs in der Schweiz? Wir können die Titel hier nicht alle aufzählen. Die Liste ist nicht ganz so üppig wie die von Walter Scott, aber sie ist: bemerkenswert, sowohl in der historischen Spannweite als auch im Publikationsrhythmus; bis 1797 erscheint beinahe jährlich ein Titel. Und offensichtlich werden sie gelesen! Kein Verleger würde sich sonst auf dieses Geschäft einlassen.
1797 aber heiratete Benedikte Naubert, da ist sie schon 45 Jahre alt; und zwar einen Kaufmann aus Naumburg. Danach Funkstille. Der Mann stirbt bald; 1802 heiratet sie zum zweiten Mal, wieder einen Kaufmann. Keine Kinder, dafür ist es sicher zu spät gewesen; aber sie nimmt einen Neffen als Pflegesohn bei sich auf. Literarisch immer noch Funkstille. Doch langsam zuckt es wohl wieder in der Feder unterm Schleier, und so erscheinen ab 1804 weiter Werke, ungefähr im zweijährigen Turnus nun. Inzwischen werden ihre Romane bereits in Englische und Französische übersetzt; so lernte sie wohl auch Walter Scott kennen, der Naubert in seiner Vorrede zur Übersetzung des Götz namentlich erwähnt und zwei ihrer Romane als „excellent romances“ bezeichnet. Und nicht nur das: Er übernimmt auch den intelligenten erzählerischen Trick, den Naubert gleich mit erfunden hat: Sie verwendet nämlich historisch unbedeutende, unbekannte Personen als Handlungsträger im Vordergrund – was natürlich auch das Interesse der Leserinnen und Leser stärker weckt und festhält –, während das historische Kolorit, sorgfältig recherchiert und ausgemalt, den Hintergrund bildet. Es sind nicht die großen historischen Helden, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen (um die kümmert sich weiterhin die große Heldenbiographie); nein, Geschichte wird vermittelt anhand der Lebensschicksale ganz normaler Menschen. Bis heute folgen die meisten historischen Romane genau diesem Muster! Naubert aber, und das ehrt sie umso mehr, bewahrt trotzdem ihren Respekt vor der ‚großen‘ Geschichte: Ihre „Fürstin“ nennt sie sie einmal, und sie sagt, im Bilde bleibend: „Ich kenne die Ehrfurcht, mit welche ich mich ihr nahen muß, besonders wenn sie verschleiert erscheint; mit ihren Zofen, der Sage und der Legende kann ich mir schon eher etwas erlauben“. Das möge man, aller demokratischen Überzeugungen zum Trotz, durchaus auch ein wenig ernst nehmen: Denn wer keinen Respekt vor der Geschichte hat, wer nicht ihre Macht und ihre Launen ebenso kennt wie ihre sehr realen Akteure und Opfer – der wird auch keinen guten Geschichtsroman schreiben!
Benedikte Naubert aber ist, und damit kommen wir zum Schluss noch ganz kurz wenigstens zu einem ihrer Werke, nicht nur zur historischen Ernsthaftigkeit fähig; nein, sie kann auch Ironie, und das ist für eine schreibende Frau zum einen nötig und zum anderen so viel erfrischender als Verbitterung und Ressentiment! Und so schreibt sie, in einem Roman mit dem schön-gendergerecht klingenden Titel Die Amtmannin von Hohenweiler aus dem Jahr 1791 (kein Geschichtsroman, im übrigen; vielmehr: „Eine wirkliche Geschichte aus Familienpapieren gezogen. Vom Verfasser des Walter von Montbarry“, so der Untertitel) im Vorbericht:
Diese Blätter, welche ich unter den geheimen Papieren meiner Frau, Jukunde Haller, gefunden habe, lege ich der Welt vor Augen; nichts davon als die Ueberschriften der Kapitel ist mein Werk, das übrige alles ist aus der Feder meiner Schwiegermutter, der Himmel tröste sie, geflossen. – Wozu doch den Weibern die Kunst zu schreiben nutzen mag? Ihre Thorheiten und die Fehler ihrer Männer zu verewigen? – Ich bedaure meinen seligen Schwiegervater, er mag in guten Händen gewesen seyn! – Mir möchte meine Jukunde mit solchen Dingen kommen. Ein jeder nehme sich das Beste aus diesem Geschreibsel, so wie auch ich gethan habe.
Soweit der – natürlich männliche – Herausgeber; aber immerhin, er veröffentlicht das „Geschreibsel“ seiner seligen Schwiegermutter, auch wenn er seinen Nutzen bezweifelt; es könnte ja gar die „Fehler der Männer verewigen“? Na gut, auch die „Thorheiten“ der Frauen, soviel Geschlechtergerechtigkeit muss ein. Aber auch besagte Jukunde selbst äußert sich gelegentlich im Roman über den Nutzen von Romanen fürs Leben (Metapoetik nennt man das heute); ja, sie erzählt sogar eine sehr lehrreiche Geschichte aus der eigenen Verwandtschaft für eine junge Dame, die immer noch an das Ideal des perfekten Mannes glaubt:
Ihr das schlimme Ende recht anschaulich zu machen, welches alle die von Romanen eingeflößte Grillen zu nehmen pflegen, hat sich leider vor kurzem ein trauriges Beyspiel in meiner eigenen Familie gezeigt. Ich habe erwehnt, was der edle Obristlieutenant von Sarnim für Amalien und ihren Mann that. Sie lebten auf seinen Gütern ruhig und bequem, aber nicht glücklich; keines nahm sich des Amtes an, das er ihnen aufgetragen hatte. Madam Feldner vertrieb sich die Zeit mit Romanschreiben, und Herr Feldner lies es sich angelegen seyn, dergleichen zu spielen. Amaliens Liebe zu ihrem Manne ward mit Untreu belohnt und ihre Werke wurden in der litterarischen Welt nicht so aufgenommen, als sie ihren Gedanken nach verdienten. Der Gram über beydes nagte an ihrem Leben, sie fiel in eine Abzehrung, und es ist noch zweifelhaft, ob der Schrecken über ein neuentdecktes Liebesverständniß ihres Mannes mit dem Gärtnermädchen, oder über eine an eben dem Tage gelesene hämische Rezension eines ihrer Lieblingswerke, ihrem Leben ein Ende machte.
Vielleicht wäre es für Amalie, die sich die Zeit mit Romanschreiben vertrieb, besser gewesen, unter dem glücklichen Schleier der Verborgenheit vor Lob und Tadel sicher zu sein? Ach, die Ironie ist selbst ein wenig bitter. Benedikte Naubert jedoch ist, mit Jukunde Haller, vor Lob und Tadel – denn auch Lob kann ein Fluch sein! – endgültig sicher; weshalb wir den Schleier der glücklichen Verborgenheit wohl noch ein wenig mehr lüften dürfen, als es bisher schon geschehen ist. Deshalb, für die Nachwelt und fürs kulturelle Gedächtnis und für alle, die gelegentlich in historischen Roman schmökern: Es war eine Frau aus Leipzig, die den historischen Roman erfunden hat, und ihr Name ist: Benedikte Naubert!
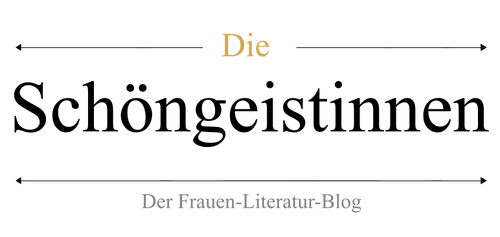

Comments: no replies