Wie ist das eigentlich, wenn einen die Muse küsst? Ach, wenn sie es doch nur täte! Ein zärtlicher Kuss, hingehaucht auf die Dichterinnenstirn, und die Worte fließen einem nur so aus der Feder, und während man sich noch den Schweiß von der Stirn wischt, erscheint schon ein perfekter Text auf dem Papier, wortstark, geistvoll, lustreich. Aber irgendwie bleibt die Szene immer eine Männerphantasie und lässt sich nicht so recht ins Weibliche mutieren: Die Musen sind traditionell reizvolle junge Damen, zumeist wenig bekleidet; sie zeigen sich beim Tanze in den vorteilhaftesten Stellungen, sie flechten neckische Kränze, und schon die Idee, dass sie dann Sappho oder Elfriede Jelinek damit bekränzen könnten – lieber nicht (das gilt aber auch für die Mehrzahl der schreibenden Männer). Lassen wir die Küsse vielleicht doch besser dort, wo sie hingehören – in der Liebe, in der Jugend, wo die Lippen noch voll sind und der Funke fliegt, ohne sich in Worte vergröbern zu müssen.
Oder ist es doch die direkte göttliche Inspiration, die mit übermenschlichem Feuer sich in die Seele des Dichters ergießt und ihn zu den kühnsten Schöpfungen begeistert? Ach, wenn man doch daran glauben könnte, wenigstens an eine Art Genius-Placebo! Ersatzweise haben Generationen religiös unbegabter Dichter versucht, den göttlichen Rausch durch weltliche Rauschmittel zu induzieren – was gelegentlich sogar funktionieren soll. Allerdings zeigen die solcherart empfangenen Geisteskinder häufig deutliche Spuren ihrer eher wüsten Zeugung und müssen, bevor man sie öffentlich vorzeigen kann, von allerhand Geburtsschleim gereinigt werden. So manches überlebt diesen Prozess nicht; nicht alles, was nahe am Wahnsinn ist, ist deshalb schon Dichtung.
Und dann kam Pegasus. Für die Griechen war Pegasus eigentlich nur ein ganz normales mythologisches Vieh, geboren aus ihrer ungebremsten, vor delikaten Vermischungen nicht Halt machenden mythischen Phantasie: als Sohn des Meeres- (und im Zweitberuf Pferde-)gottes Poseidon und der schlangenköpfigen Medusa, entsprang er, als der Heros Perseus die männerverderbende Ex-Schönheit köpfte, ihrem Haupte als geflügeltes Pferd. Anschließend machte er sich auf dem Weg zum Olymp und stellte sich Zeus als Donner- und Blitzbote zur Verfügung. Auf einer seiner Botentouren erschuf er, eher beiläufig, mit einem halbgöttlichen Huftritt die Musenquelle Hippokrene auf dem Musenberg Helikon – deren Genuss künftig, siehe oben, die Dichter zu ihren schönsten Phantasien beflügeln sollte. Pegasus jedoch wurde am Brunnen überrascht und gezähmt von Bellerophon, der ihn als Schlachtross brauchte, um die Chimäre zu besiegen.
Die Chimära, ein weiteres mythologisches Ungeheuer, konnte es durchaus mit Pegasus aufnehmen: Ihr Löwenkopf saß auf einem Ziegenkörper, der in einem Drachen-Schlangen-Schwanz endete. Offensichtlich durfte man ein solches Monster nicht leben lassen, obwohl etwas unklar bleibt, was sie eigentlich verbrochen hatte; aber im Mythos gibt es Monster in erster Linie, damit Helden sie töten können, weil das eben der Stoff ist, aus dem Heldendichtungen gemacht werden. Bellerophon also machte der Chimäre mit Pegasus den Garaus – aber dann wurde er übermütig und lehnte sich gegen den Göttervater, gegen Zeus selbst auf. Zeus jedoch, und hier kippt das Heldenepos leicht schräg ab in die Travestie, schickte eine göttliche Bremse (nein, kein Fabelwesen, einfach eine Stechmücke); und die Bremse stach Pegasus, und Pegasus bäumte sich, Fabelwesen oder nicht, auf, und der Held fiel herunter und war fortan keiner mehr, sondern tot. Pegasus aber wurde von Zeus unter die Sterne versetzt, und dort thront er heute immer noch, im nach ihm benannten Sternbild. Und niemand wird wissen, ob er nicht lieber weiter ein einfacher Pferde-Blitzbote geblieben wäre, der gelegentlich einen Schluck zu viel aus der Hippokrene nahm. Die Geschichte zeigt jedoch, dass man gut im Sattel sitzen muss, wenn man das Dichterross reiten will; es trägt einen zwar überall hin mit seinen Flügeln, aber irgendwie muss man auch wieder zurückkommen, und geflügelte Worte allein machen noch kein Werk. Gelegentlich geht der Dichter besser zu Fuß, und Chimären könnte man auch einfach leben lassen und in Zoos ausstellen, bis die Menschheit es endgültig geschafft hat, der Mythologie durch Genetik auf die Sprünge zu helfen.
Shakespeare aber schuf Ariel. Ariel ist ein Luftgeist, in der älteren Überlieferung: ein gefallener Engel – oder ist er doch ein Dämon? Wer weiß das schon, Gut und Böse werden in einer gewissen Entfernung unscharf und wechseln die Farbe je nach Betrachter. Ariel jedoch umkreist die Erde in zwei Sekunden; er ist unsichtbar und allmächtig, er flüstert den Menschen die Liebe ein und den Hass, er verfügt über die Elemente und die Seelen gleichermaßen. Zehn Jahre wurde er auf einer Zauberinsel in einem Baum von der Hexe Sycorax gefangen gehalten, und wie soll man sich vorstellen, was das für den Beweglichsten, den Luftigsten von allen bedeutet hat? Aber dann befreite ihn Prospero, ein alter müder Zauberer, dem er nun untergeben ist; vielleicht hieß der Zauberer auch Shakespeare, für eine Weile, oder Goethe, oder Homer. Aber Ariel ist nicht für immer zu fesseln, nicht durch Bäume und nicht durch Zauberei und schon gar nicht durch Worte. Er lebt in den Winden, dem Atem der Welt; er schwimmt in den Bächen und im Meer, die alles Seiende durchströmen; er wühlt in der Erde, aus der alles wächst, und er ist unwiderstehlich im Feuer. Wenn Ariel eine Dichterseele in Besitz nimmt, als Hauch, als Strömung, als Samen, als Funke, dann explodiert sie – die Synapsen fangen an hysterische Netze zu spinnen und die Neuronen feuern nach allen Seiten.
Ariel aber kommt nur zu denen, die ihn nicht fürchten. Alle anderen spüren vielleicht, gelegentlich, ein unbestimmtes Lüftchen, einen kräuselnden Wellenschlag, eine kleine ungewohnte Sensation in ihrer Seele, aber sie würden vergehen an seinem stärksten Feuerwerk und an seinem unmenschlichen All-Blick. Ariel schert sich nicht um Gut oder Böse, Richtig oder Falsch; er kennt keinen Gott, er kennt keinen Menschen, er kennt nur die Elemente und ihren immerwährenden Sturm und seine grenzenlose Freiheit, die ihm nur eines befiehlt: zu schaffen. Vergesst Ariel besser. Ahnt ihn allenfalls. Aber kommt ihm nicht zu nahe.
Wir aber sind Gelegenheitsschreiberinnen. Mal küsst uns die Muse im Vorbeigehen, sehr flüchtig. Sie hat sich herausgeputzt wie ein Party-Girl und macht die ganze Zeit Selfies, den Kussmund dick geschminkt und knallartig zugespitzt. Dann wieder tritt uns ein Pferd, fast ist das besser, es tut wenigstens ein wenig weh. Ariel sehen wir höchstens im Flugzeug an uns vorbeihuschen, wenn es endlich Reiseflughöhe erreicht hat, aber er ist schneller als der Schall und nur sein mitleidiges Lächeln bleibt einen Moment stehen im leeren Raum. Wir aber schreiben, gelegentlich, uns etwas von der Seele. Oder vom Leib. Wir schämen uns dabei, weil es ja wirklich nicht unbedingt sein muss; und Dichtung, da ist Ariel ganz streng, sollte eigentlich notwendig sein – ein Stück vom eigenen Fleisch, beseelt von einem Schmerzenshauch der eigenen Seele, gewendet und gestaltet zu etwas Neuem. Ist es aber gestaltet, dann ist ein Ding mehr in der Luft. Es muss nicht schön sein, es trägt gar leicht an seiner kleinen Bedeutung, es torkelt noch ein wenig unsicher durch den neuen Raum, vielleicht ist es doch zu früh geboren? Als Mutter sorgt man sich und schneidet die Nabelschnur nur schweren Herzens durch. Vielleicht, dass Ariel es übersieht in der Masse der aufgeblähten Schäume und Seifenblasen.
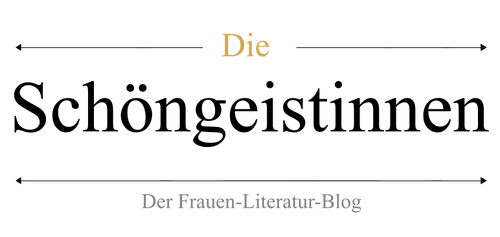

Comments: no replies